Kabul – rette sich, wer darf
„Sobald die Amerikaner abziehen, sind die Taliban wieder an der Macht“ – schrieb ein US-Analyst in einer E-Mail am 06. Oktober 2001, also einen Tag bevor der Afghanistan Krieg offiziell begann. Er war damit bei weitem nicht der Einzige. Also weder mit der Meinung, noch damit, den Einsatz auf „die Amis“ zu reduzieren, wo doch im Laufe der Zeit so viel mehr Nationen beteiligt waren. Und alle sollten recht behalten. Ein Kommentar.
Zwanzig Jahre lang warnten sie uns: Die Gesellschaft in Afghanistan könne mit „Nation Building“ nicht viel anfangen, viele seien mit dem Clan- und Warlord-System zufrieden, Rechte für Minderheiten haben sich abseits der Kameras in den großen Städten nicht nachhaltig verbessert und Korruption ist weitverbreitet und immens. Bei den „freien“ Wahlen ist wenig überraschend, dass immer die in den USA ausgebildeten Kandidaten gewinnen. Deren Verwandte bekommen von der Zentralbank ungeprüfte Kredite in neunstelliger Dollar-Höhe, die sie in Bauprojekte in Dubai investieren, um mit dem Erlös das geliehene Geld zurückzuzahlen, während sie die Gewinne behalten. Es geht schief, das Geld ist weg. Mehrmals konnte ich bei einem spezialisierten Dienstleister die Fahrzeuge sehen, welche später an Karzai und Ghani gingen. So kenne ich auch die Katze, welche die Sitze von Ghanis Wagen eine Nacht vor Auslieferung zerkratzt hat. Sie könnte nun sicher auch Karriere im neuen Afghanistan machen, da sie zum „Widerstand“ gezählt werden könnte. Man braucht sich nicht zu wundern, dass bei der ländlichen Bevölkerung in Afghanistan wenig Begeisterung für das neue System aufkommt. „Man kann Afghanen mieten, aber nicht kaufen“ heißt eines der lokalen Sprichwörter. So sehen es auch viele der Afghanen, die für die neue afghanische Armee arbeiten. Es ist ein Job, der einen vor den Kontrollen der NATO-Truppen schützt und Essen auf den Tisch bringt.

Am Donnerstag, dem 12. August 2021 schrieb mir ein Bekannter aus Kabul, dass ich allen in meinem Umfeld sagen solle, dass sie maximal eine Woche haben, um zu verschwinden. Am Freitag, dem 13. August, korrigierte er auf 48 Stunden. Er hatte recht damit, dass die Taliban dann dort waren, doch blieb das Fenster für Menschen mit westlichem Pass länger offen.
Dass alles zusammenbrach, war also nicht verwunderlich. Verwunderlich war eher, dass die Taliban die westlichen Menschen in Ruhe fliegen ließen. Dem Scheiternden so viel Seil geben, dass er sich selber daran erhängt. Etliche westliche Nationen sind in Panik geflohen, viele haben sich dabei völlig lächerlich gemacht, die Taliban konnten sich zurücklehnen und darüber lachen. Ein exzellenter PR Erfolg.
Alle raus!
Vor allem Amerikaner und Briten begannen schnell, ihre gut geölte Militärmaschinerie in Bewegung zu setzen. In kleinerem Rahmen auch Kanada, Neuseeland und Australien. Zwischen Kuwait City, Doha, Dubai und Kabul entstand binnen Tagen eine Luftbrücke, welche aus großen C-17 Frachtmaschinen, KC-135 Tankern, B-52 Bombern und etlichen kleineren Flugzeugen bestand. Nach dem Abzug der türkischen Armee übernahmen die Amerikaner die Sicherung und den Betrieb des Flughafens.
Die Lage in Afghanistan war zu dem Zeitpunkt für westliche Flüchtlinge noch in Ordnung. Man kam per Taxi zum Flughafen und konnte irgendwie ausfliegen. Doch die Meldungen überschlugen sich. Nach und nach hatte man das Gefühl, dass auch die Bundesregierung ein Fax zur Lage vor Ort erhalten hatte und auf dem Globus das Land suchte. Ich fragte mehrmals bei Bekannten in den verschiedenen Ministerien nach. Diese winkten noch am 14. August ab: Wochenende. Am Montag, dem 16. August hieß es dann, natürlich habe man das alles kommen sehen und im Blick gehabt, es sei alles ok, ich solle mich nicht immer melden, alle Leute würden ganz problemlos ausgeflogen werden. Von Seiten der Amerikaner klang es anders. Die Belegschaft der deutschen Botschaft sei ohne Anmeldung mit einem Konvoi bei der US-Botschaft in Kabul aufgeschlagen. Man habe sie sofort rein gelassen, ihnen Wasser gegeben, sie in den nächsten CH-47 Transporthubschrauber gesetzt (also vor den eigenen Leuten priorisiert), sie zum Flughafen geflogen und sofort außer Landes gebracht. Diese Details sollten später wichtig werden, als sich die Vorwürfe gegenüber den Amerikanern und der angeblich schlechten Zusammenarbeit mehrten.
Nach und nach zog man in Deutschland KSK und Fallschirmjäger zusammen, flog diese nach Taschkent und Kabul. Nachdem die anderen Nationen mehr als 10.000 Menschen ausgeflogen hatten, kam also die Bundeswehr vor Ort an. Die Soldaten haben exzellente Arbeit geleistet – wurden aber durchgehend von den Formalien behindert, die ihnen aufgebürdet wurden.
Kabul Airlift
Der Ablauf am Flughafen für Nicht-US-Nationen war wohlorganisiert: Man machte mit den Amerikanern aus, wann etwa die eigenen Maschinen landen sollten. Der improvisierte Tower unter einem Gartenpavillion wusste Bescheid und ließ das Flugzeug landen. Zuvor erhielt man ein Gate, über welches man seine Passagiere rein bringen sollte. Hier musste ein Mitarbeiter der jeweiligen Nation mit einer Liste stehen, die Fahrzeug, Kennzeichen, Fahrer und Gäste beinhaltete. Die Identitäten wurden geprüft, die Leute kamen auf ihren Platz und warteten. Teilweise mehr als 24 Stunden, da es immer wieder Probleme im Ablauf gab. Nach Angaben der Amerikaner fehlten zu Beginn die deutschen Mitarbeiter. Einer soll aufgrund der Verkehrslage zu spät gekommen sein, weswegen Bundesbürger nicht mit ins Flugzeug kamen. Der erste Flug der Luftwaffe landete und hatte dreißig Minuten, um seine Passagiere aufzunehmen.
Wir sprechen bei fast allen Evakuierungsfliegern von Frachtmaschinen, welche über eine meterbreite Laderampe verfügen und bei denen bereits vorher geprüft wurde, wer berechtigt ist mitzufliegen. Man kann ein Flugzeug in so einer Situation binnen Minuten mit Menschen befüllen, welche sich noch sortieren können, während das Flugzeug schon zur Startbahn rollt. Angeschnallt ist eh kaum jemand, man sitzt hintereinander auf dem Boden, Rücken an Knie.
Die Maschine der Luftwaffe verließ Kabul mit sieben Passagieren – die der Amerikaner mit mehr als 700. Die Amerikaner waren außer sich. Sich nicht an die Absprache halten, weder die Liste noch die Passagiere vor Ort haben und sich dann weigern, den Flieger mit weiteren Fliehenden zu füllen. Ein in Doha arbeitender und an der Luftbrücke beteiligter Amerikaner kommentierte es mit den Worten: „Wir hätten 45 eine Atombombe auf Berlin werfen sollen, dann wäre uns die Scheiße erspart geblieben“.
Bei einem Treffen mit einem Mitarbeiter aus dem Kanzleramt heißt es, es sei weder Inkompetenz noch irgendein Abspracheproblem. Es sei genau so gewollt. Einige Parteien hätten Sorge, kurz vor der Wahl zu viele Afghanen auszufliegen und so die Rassisten in Deutschland als Wähler zu verlieren. Offiziell wollte diese Aussage niemand bestätigen – doch es wurde hartnäckig gefragt, wer genau sich wann und wo mit mir getroffen habe.
Informationen tauschen
Am 15. August erhielt ich die Nachricht einiger Contractor (also Soldaten aus dem privaten Sektor, früher nannte man sie Söldner), dass sie nun auf dem Weg nach Doha seien. Sie waren bisher meine beste Quelle vor Ort gewesen. Doch in den wenigen Tagen hatten sich etliche überschneidende Gruppen von Menschen gefunden, welche Informationen zu verschiedenen Zwecken tauschten. Das Problem dabei ist, dass einige Menschen Informationen zu schnell veröffentlichen – meist die, die Geld damit verdienen, wie z.B. Journalisten oder Consultants aus dem Bereich. Andere Beteiligte sind einfach paranoid, wieder andere leben von Fördergeldern und haben Sorge, eine andere Organisation könnte ihnen diese abgraben, wieder andere kennen sich nicht gut genug. Es entsteht ein Wildwuchs von Chatgruppen, Maillisten und Twitterthreads. Als die westlichen Bodentruppen in Kabul verstärkt wurden, waren Bekannte von mir dabei, was die Sache wieder einfacher machte. Zusätzlich meldete sich ein Contractor vor Ort, mit welchem ich gemeinsame Freunde hatte. Die Nachrichtenlage besserte sich – die Situation vor Ort wurde immer schlechter.
Schnell mehrte sich die Kritik an der Bundesregierung und deren Krisenstäben. Absprachen wurden nicht eingehalten, Nachts war oft niemand erreichbar und alle Probleme wurden auf die Amerikaner geschoben. Während nun zehn Nationen ihre Landsleute mit eigenen Flugzeugen ausfliegen konnten, sollten die Amerikaner vor Ort also einzig und allein die Deutschen sabotieren. Eine sehr schräge Geschichte. Doch es wurde problematischer: Konnte man zunächst noch eigene Deals mit den Amerikanern machen, so wollten diese einem nicht mehr helfen, wenn man erstmal auf einer Liste des Auswärtigen Amtes stand. Also begannen Deutsche, sich dort nicht mehr zu melden, um ihre Evakuierung nicht mehr zu gefährden.
Pronto Pedes und Pineapple Express
Als sich die Deadline des Abzugs der Amerikaner näherte, stieg der Druck, die letzten Menschen außer Landes zu bekommen. Inzwischen waren auch die Letzten bereit, einen Pakt mit dem Teufel einzugehen, um raus zu kommen. Die Chats wurden sortiert: Bizarre und interessante Geschichten, eigene Koordinierung, wichtige Informationen.
Zu den bizarren Geschichten gehörte eine Gruppe, welche ihre Aktion(en) „Pronto pedes“, also „schnell zu Fuß“ nannte. Sie hatten zwei EU-Bürger zu Fuß aus Herat im Westen Afghanistans geleitet, dort kauften diese beiden ein Moped und fuhren über mehr als zwei Stunden zur iranischen Grenze. Hier verhandelte sie über ein Visum zur baldigen Ausreise. Alle Beteiligten sollen höflich gewesen sein, aber es zog sich. Sie durften rüber, das Moped nicht. Also ging es weiter: Zu Fuß, per Anhalter, im Taxi, Bus und endlich per Flugzeug, über die Türkei in ihr Heimatland.
Mehrere europäische Unternehmen und Institutionen schlossen sich zusammen und charterten bei einer lokalen Airline ein ganzes Flugzeug, welches aber vergeblich auf sie wartete. Während der Flieger bereits bezahlt war, boten die Amerikaner die schnelle Ausreise in einer C-17 an. Sie schrieben also die Kosten für einen Charterflug eines ganzen Airliners ab, nur um schneller raus zu kommen.
Wieder andere hatten das Problem, dass der Busanbieter zwar Fahrer und Kennzeichen übermittelt hatte – der Fahrer mit dem Bus an diesem Tag jedoch in einer anderen Provinz war. Was ist nun schneller? Kennzeichen und Ausweis drucken oder den Fahrer samt Bus auftreiben?
Und es gab Detailprobleme: Im Chat der belgischen Contractor wurde ausschließlich in Flämisch kommuniziert. Die Idee dahinter: Wer auch immer den Chat überwachen könnte, muss einen flämischsprachigen Dolmetscher vorhalten. Die sind seltener, als man meint. Auch eine interessante Schutzmaßnahme.
Wieder andere berichteten davon, dass sie mit der amerikanischen Privatarmee Academi (ehemals Blackwater) Kontakt aufgenommen hatten, um sich gegen 9.000$ pro Person von diesen ausfliegen zu lassen.
Es zeichnete sich ab, dass Mittwoch, der 25. August ein entscheidender Tag werden sollte. Auch hier gab es ein Problem: Teilt man allen mit, dass sie ihre letzten Aktionen auf diesen Tag konzentrieren sollen und bündelt so seine Aktionen? Oder könnte es zu früh raus kommen und für Probleme sorgen? Am Nachmittag startete dann eine Maschine der katarischen Luftwaffe in Doha. Mit an Bord waren mehr als zehn internationale Journalistinnen und Journalisten. Die Sorge aller Beteiligten: Jemand hat ihnen einen Tipp gegeben.
Am Vortag und an diesem Tag wurden Menschen aus ganz Afghanistan zusammengezogen. Vor allem Afghanen, aber auch letzte westliche Personen, die man vorher nicht erreichen konnte. Nach und nach wurden sie in Wohnungen, Geschäften und Cafés gesammelt. Manchmal nur wenige, manchmal mehr als zwanzig. Welche beteiligte Gruppe wie viele Menschen von wo auch wo raus bringen wollte, war lange unklar. Koordiniert wurde die Aktion maßgeblich von amerikanischen Special Forces, welche viel Erfahrung mit solchen Aktionen hatten. Doch es mussten weit mehr Soldaten ein Auge zudrücken, damit alles lief: Von den Koordinierenden in Doha über die Zuständigen am Flughafen Kabul, bis hin zu Teams, welche inkognito in Afghanistan unterwegs waren. Einige von ihnen mussten am Rande ihrer Befehle agieren. Der zentrale Chat, welcher „in einem verschlüsselten Chatnetzwerk“ lief, war am Ende eine eher kleine Chatgruppe in einem bekannten Messenger.
Kurz vor Beginn der „Anlieferung“ der Leute wurden wenige Details für die „Zulieferer“ bekannt gegeben. Das Erkennungszeichen war eine Ananas. Es folgten schnelle Rückfragen: Eine Echte? Was für eine? Wie? Die Antwort war einfach: „Egal. ANANAS!“. Also googelten die Beteiligten Fotos von einer Ananas, zogen sich ein T-Shirt mit dem Haus aus der Kinderserie „Spongebob“ an oder malten eine. Es klang bizarr. Name der übergeordneten Operation war „Pineapple Express“ („Ananas Express“). Der gleichnamige Film beginnt mit einer Szene, in der ein US-Soldat gefragt wird, wie er über seine Vorgesetzten denkt. Er bricht in Lachen aus. So sahen viele der Beteiligten inzwischen die Biden-Administration. Und während die Bundeswehr bereits zurückbeordert wurde und Soldaten befohlen worden war, ihre ehemaligen lokalen Kollegen im Stich zu lassen, hatten die US-Soldaten vor Ort mehr Freiheiten und die schützende Hand eines Vorgesetzten über sich.
Einige der „Pakete“ wurden über die Mauer des Flughafens „angeliefert“, andere über die großen Tore, wieder andere durch Versorgungsschächte. Später mehrten sich detaillierte Berichte der Evakuierung. Mehrere Personen, getarnt als eine Familie, wurden von einer Taliban-Streife gesichtet. Der „Vater“ der Familie war ein US-Elitesoldat. Ihm war klar, dass das wichtigste ist, in so einer Situation nicht weiter aufzufallen. Also ließ er sich von einem jungen Taliban verprügeln und nach Hause schicken, statt sich einen auffälligen Kampf zu liefern. Ein französischer Soldat kommentierte es prompt mit den Worten „Ah, wohl doch nicht so gut, eure Nahkampfausbildung ;)“, und schickte ein Foto von einem Taschenmesser mit einer ausklappbaren weißen Flagge. Als die Sonne aufging, waren mehr als 500 Menschen evakuiert worden. Die Aktion war ein voller Erfolg.
Doch was war mit den Journalisten, die genau während dieser Zeit am Flughafen aufgeschlagen waren? Sie waren von der US-Militärpolizei zu einer Maschine nach Doha eskortiert und ausgeflogen worden. Kein Erfolg für die Pressefreiheit.
Im Laufe der folgenden Tage meldeten sich mehr und mehr Menschen, die von der Aktion erfahren hatten und noch raus wollten. Den wenigsten konnte man noch helfen. Vereinzelt wurden Personen mit westlichem Pass an Contractor vermittelt, welche selber auf dem Weg nach Hause waren. So gab es fünf Bundesbürger, welche mit einem kleinen Contractor-Konvoi bis kurz vor Pakistan fuhren, die Grenze zu Fuß überquerten und einige Kilometer weiter wieder aufgenommen wurden. Das fehlende Visum störte dort niemanden, da sie eh nur ausreisen wollten.
Doch die meisten Menschen vor Ort wurden verlassen. Es gibt immer noch mehr als 100 Bundesbürger und tausende Ortskräfte, welche einfach zurückgelassen wurden. Raus kamen vor allem die, die sich selber um ihre Evakuierung gekümmert haben. Eine traurige Bilanz.
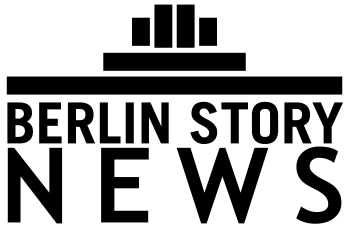
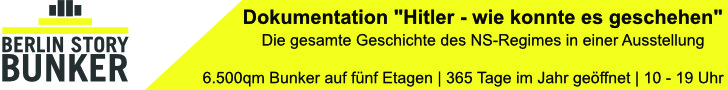
Ein Kommentar