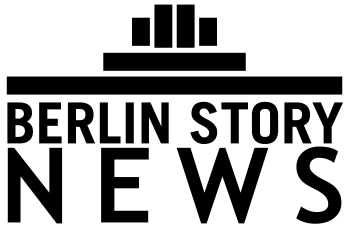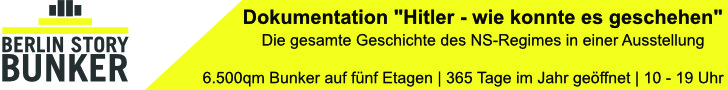Kriegsberichterstattung – der spannendste Teil des Journalismus. Immer wieder sprechen mich Menschen an, die in diesem Bereich starten wollen: Abenteuer, Kriminelle, Waffen und der Geruch von Napalm am Morgen. Sie erwarten die brisante, interessante und wilde Fahrt am Abgrund, von der sie später daheim bei einem Whiskey ihre Geschichten erzählen können. Doch die Realität ist oft einfacher. Die Amerikaner sagen „War is boring – until it’s not“ (Krieg ist langweilig – bis er es nicht mehr ist). Und für viele „Kriegsberichterstatter“, die die Front nie gesehen haben, ist es auch wenig aufregend. Ein Alltagsjob mit viel Recherche. Abfällig werden sie von den anderen „Kriegsgerüchterstatter“ genannt. Doch verbringt man zu viel Zeit „im Feld“, an der Front, da wo es knallt, dann kann sich das Leben ändern. Menschen werden einsam, traurig, depressiv und/oder haben Probleme mit dem normalen Leben daheim.

Das Spannende an der Kriegsberichterstattung ist, immer vorne dabei zu sein. Immer als Erster wissen, was geschieht, immer als Erster die Fakten zu haben. Man kann die halbgaren Gerüchte von Twitter schnell prüfen, indem man vor Ort sehen kann, wie die Lage wirklich ist. Doch es ist schwierig. Man muss in der Lage sein, schnell einen Überblick zu bekommen und man muss genug Zeit mitbringen, um andere Menschen kennenzulernen, ihr Vertrauen zu erlangen und ihnen selber zu vertrauen. Im Zweifel muss man diesen Menschen sein Leben anvertrauen. Manche Menschen können das, andere eben nicht. Die Geschichten, die man später erzählen kann, begrenzen sich meist auf die, bei denen man gut wegkommt oder lustige Dinge.
Vor Jahren waren wir in einem Camp, als ein deutscher Politiker, der dort zu Besuch war, zur Toilette ging. Als er wieder kam, regte er sich über die komischen Toiletten dort auf. Eigentlich gab es dort wo wir waren, hinter einer sauberen Dusche eine ganz normale westliche Toilette. Niemand maß seiner Bemerkung etwas bei. Später wurde es bei unseren Begleitern unruhig. Irgendetwas war geschehen. „Jemand hat in die Dusche gekackt“, fasste es der Übersetzer zusammen.
So etwas kann man gut erzählen. Auch, dass man beschossen wurde oder wie anders die fernen Länder doch waren. Aber die Arbeit geht darüber hinaus. Im Krieg geht es oft grausam zu und immer wieder können Dinge passieren, die einem selber unangenehm zu erzählen sind: Die vielen Menschen, denen man nicht helfen konnte. Oder wie man verhungernde Menschen fotografiert hat, bevor man wieder ins Hotel fuhr. Die Welt ist so, man kann in dem Moment wenig machen. Aber man kann es den Leuten Zuhause kaum vermitteln.
Einem Kollegen flogen nach einem Luftschlag verkohlte Leichenteile um die Ohren. In dem Moment war er gefasst, regierte gut, kam heil aus der Situation raus. Erst später, in Deutschland, merkte er bei einem Grillabend, dass er doch schwerer traumatisiert war, als erwartet. Das verkohlte Fleisch auf dem Grill konnte er einfach nicht mehr ertragen. Dabei ergibt sich eine interessante Diskrepanz: Körperliche Verletzungen werden häufig wie Trophäen vorgezeigt, psychische werden versteckt.
„We’re going to war“

Vor sechs Jahren erhielt ich von einem Soldaten, den ich bei früheren Reisen kennen gelernt hatte, die Nachricht „we’re going to war“ (Wir ziehen in den Krieg). Ich war einer der Ersten, der von der Mobilisierung der Peschmerga in der Region wusste. Er schickte mir täglich Fotos, Lageberichte und mehr. Wir machten lose aus, dass wir uns bald vor Ort treffen. Es hatte sich eine enge Beziehung ergeben, fast wie Freunde. Wir sahen uns nie wieder. Ich weiß nicht mal, wo sein Grab ist. Sein Körper wurde zerfetzt und vor Ort mit vielen anderen beerdigt. Er war der Erste tote Kontakt den ich vor Ort hatte, es folgten mehr als ein Dutzend.
Man gewöhnt sich daran. Es wird ein Teil des Ganzen. Wenn sich jemand nicht mehr meldet, überlegt man zwei mal, ob man genauer nachfragt. Stelle keine Fragen, deren Antwort du nicht wissen möchtest. Manchmal war nur das Handy kaputt, manchmal ist es eben mehr. Dazu kommen die Menschen, an denen man vorbei lief und von denen man weiß, dass ihnen nicht mehr zu helfen ist.
Wie geht man damit um?
Kommt man wieder nach Hause, so trifft man auf eine andere, fremde Welt. Es ist der gleiche Planet, aber viel mehr hat das eine mit dem anderen nicht zu tun. Ein Kollege twitterte gerade:
„Ich habe gerade einen Freund aus Beirut in Paris getroffen, seine erste Reise nach der Bombe. Er wurde fast getötet, verlor viele Freunde, sein Haus wurde zerstört und Orte, an die er gehen würde, das Haus seiner Freundin wird zerstört, die korrupte Regierung nahm 80% seiner Ersparnisse. Ja, in Deutschland hat man Erste-Welt-Probleme.“
Die Leute gehen unterschiedlich damit um. Einigen helfen Gespräche mit ihren Freunden und Verwandten. Viele trinken mehr, als sie sollten. Wenige wählen den Freitod. Die wenigsten reden offen darüber. Bei den Mitgliedern des „Bang Bang Club“, welche die Rassenunruhen in Südafrika dokumentierten, kann man einen traurigen Querschnitt dieser Szene sehen. Sie gehörten zu den besten Fotografen der Welt, mit allen großen Preisen ausgezeichnet. Wirklich reich wurden sie davon nicht, einige gingen an dem Erlebten zugrunde.
Warum macht man es?

Weil man vor Ort auch viele Dinge sieht, die Hoffnung geben. Die Hoffnung derer, die etwas wieder aufbauen wollen. Solidarität unter den Überlebenden. Familien, die sich wiederfinden. Und weil man das, was sonst im Verborgenen bleibt, an die Öffentlichkeit bringen möchte. Die Geschichten derer, die sonst nicht gehört werden.
Viele Kriegsberichterstatter treibt die Gier nach Wissen an. Und der dauernde Wettbewerb, besser als die anderen zu sein: Früher bessere Informationen haben, das beste Foto des Lebens zu schießen, aber auch, um der Welt als Erster erklären können, was wo warum geschehen ist.
Man sollte den Job also nicht machen, weil man ihn interessant findet. Aber man sollte ihn machen, wenn man ihn machen kann.