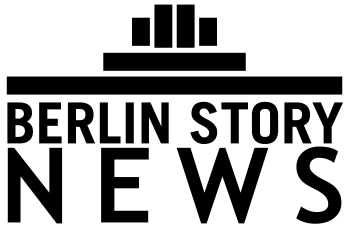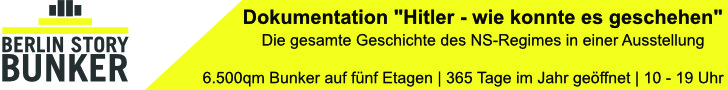Roadtrip mit einem Helden

Nachdem die Mossul Offensive gestartet war, wollte ich zurück nach Kurdistan (Irak) und meine Freunde vor Ort besuchen. Ich wollte wieder aus erster Hand erfahren, wie es voran geht und wo die Schwierigkeiten liegen. Ich mache diese Trips in meiner Freizeit, musste also erst mal den „Urlaub“ planen. Als ich losfliegen konnte, hatten die Peschmerga aber bereits Ihren Teil der Arbeit abgeschlossen. Es gab nur noch kleinere Gefechte am Rande – den Rest sollte die irakische Armee zusammen mit den US-Marines und weiteren Spezialeinheiten machen. Der Druck verlagerte sich dadurch aber weiter nach Süden. Kirkuk und Hajiwa wurden nun als die nächsten Problemzonen gehandelt. Also zog es mich dort hin. Vor meinem Abflug hörte ich auch die Geschichte von Ako, dem „Helden von Kirkuk“, der zusammen mit seinem Freund Abbas mehr als siebzig Menschen mit einem alten gepanzerten BMW gerettet hat. Er ist immer wieder durch das IS-Feuer zur Front gefahren um Runde für Runde weitere Menschen aus der Gefahr zu holen. Ihn wollte ich treffen. Aber der Weg dahin war wie immer nicht ganz einfach.
Wie bereitet man den Trip vor?
Inzwischen war ich oft vor Ort. Ich kenne die geografische, politische und militärische Landkarte, weiß wie man sich dort beim Protokoll und in der Kaserne verhält, wo man im Divan-Hotel die Waffen abgeben muss und wo man man den besten frischen Granatapfelsaft bekommt. Vor meiner ersten Reise in die Gegend und vor allem an der Front war ich extrem aufgeregt, inzwischen ist Routine drin. Aber es gibt ein paar Dinge zu beachten. Die Gegend und die Bevölkerung ist politisch zweigeteilt. Im Nord-Westen dominieren die Anhänger der größeren Regierungspartei PdK, der viele Baranzis angehört. Im Süd-Osten dominieren die Anhänger der kleineren Regierungspartei PUK, der viele Talebanis angehört. Man wirft sich gegenseitig Vetternwirtschaft und Korruption vor und der Teil der Armee, der zu den jeweils anderen gehört, ist besser ausgestattet, gibt aber nichts ab. Ich habe beide Teile ausführlich gesehen, jeweils die Sondereinheiten, Krankenhäuser, Kaufhäuser, Bombenräumkommandos und Autohäuser angeguckt. Im großen und ganzen geht es den Leuten gleich gut bzw. gleich schlecht und die Peschmerga haben auf allen Seiten eine viel zu schlechte Ausstattung. Für meine Trips ist diese politische Grenze jedoch nicht so entscheidend. Nach außen arbeiten alle zusammen. Sie kämpfen gegen die gemeinsamen Gegner, sie treten politisch für die gleichen Sachen ein und sie schützen mich auf beiden Seiten gleich gut. Aber: Die Soldaten aus dem einen Bereich können nicht immer ohne weiteres mit ihren Waffen über die Checkpoints in den anderen Bereich.
Ich war oft im PdK Gebiet, den Premierminister Nechirvan Barzani (PdK) kenn ich seit fünf Jahren, er hat mir oft geholfen. Als wir vor zwei Jahren im PUK Gebiet kaum noch Benzin hatten (eine wochenlange Krise in der Gegend) hat der Vize-Premierminister Quabad Jalal Talabani (PUK) uns ausgeholfen. Im vergangenen Jahr habe ich eine Woche beim Peschmerga-Kriegshelden Kaka Hama (KSDP, sozialistische Partei) gewohnt. Beide Seiten haben ihre Millionenstadt (Erbil im Norden, Sulaymania im Süden) mit einem internationalen Flughafen. Die Gemeinsamkeiten sind also größer, als die Unterschiede. Aber im Alltag gibt es immer wieder Seitenhiebe von der einen zur anderen Seite – wird aber von außen oft dramatischer gesehen, als es dann vor Ort ist.
Dieses Mal ging es in das PUK Gebiet und da auch viel weiter nach Süden, als ich je war. Am Ende waren wir rund 120km nördlich von Bagdad. Es musste also alles an Equipment mit, was man abseits der Versorgungslage brauchte. Ich sollte auch wieder eine Gasmaske mitnehmen, da es Giftgasangriffe gab. Die schusssichere Weste Klasse 4 sowie ein ballistischer Helm und das Combat 1st-Aid Kit zur Versorgung von Schussverletzungen gehört schon zur normalen Ausrüstung. Ich lud mir die topographischen Karten der Gegend auf das Handy, um zu wissen wo wir sind und um im Zweifel in die richtige Richtung zu laufen, sollte ich irgendwo alleine enden. Dazu Wasserreinigungstabletten und ein paar Energieriegel. Das braucht man eigentlich nicht in der Gegend – aber sollte man doch mal alleine bis zur nächsten Stellung laufen müssen, sind das die Dinge, die einen den Weg gut überstehen lassen.
Neben der Kleidung waren noch Stapel von Akkus, Kameras, Kabeln usw. im Gepäck und dann konnte es an sich los gehen. Aber wie sollte ich zu Ako kommen?
Mein guter Freund Kawa Prüfer ist ein deutscher Peschmerga an der Südfront. Ich fragte ihn, ob er eine Idee habe, wie man Ako ausfindig machen könne und dann auch zu ihm kommt. „Kak Ako? Klar kenne ich, fahre ich dich rüber!“ – ok das hatte ich mir komplizierter vorgestellt. Kak bzw Kaka (je nachdem, ob ein Vokal folgt) heißt „Bruder“ und bezeichnet eine Waffenbrüderschaft oder eine gemeinsame sozialistische Gesinnung. Man könnte es also als „Kamerad“ oder „Genosse“ übersetzen. Kawas Mutter ist vor Ort als Kämpferin bekannt und sie kümmerten sich um die weiteren Verbindungen um den Trip zu ermöglichen
Anreise – eine Odyssee
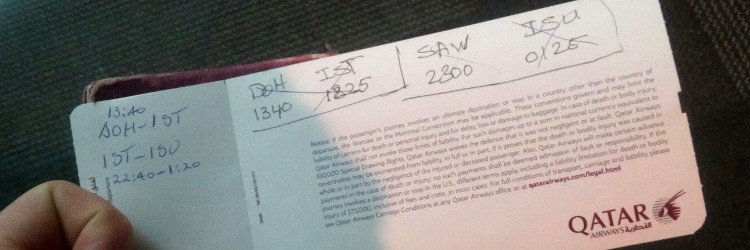
„Wie kommt man dahin?“ ist eine häufige Frage. Ganz einfach mit dem Flugzeug. Nur vier Flugstunden von München aus, Non-Stop. Von Berlin aus muss man umsteigen. Von der Zeit her passte ein Flug über Doha am besten, auch wenn man dabei an sich einen Bogen fliegt. Angekommen in Doha hieß es: Heute keine Flüge mehr in den Irak! Vielleicht morgen, sonst übermorgen. Alles diskutieren half nichts, es gab keine Flüge. Das passiert immer wieder. Manchmal sind Teile des irakischen Luftraumes gesperrt, weil russische Kampfjets nach Syrien verlegt werden, weil die US-geführten Luftangriffe stattfinden oder weil russische Marschflugkörper im schwarzen Meer starten und über den Iran und Kurdistan (Irak) Richtung Syrien fliegen. Aber das war mir eigentlich egal. Nach ein bis zwei Eskalationsstufen erhielt ich von Quatar Airways ein handgeschriebenes Flugticket für einen Türkisch Airlines Flug über Istanbul. Das waren 4.500km Umweg und 14h mehr Reisezeit – und es sah auch nicht sehr vertrauenerweckend aus. Aber am Ende klappte es und ich kam in den frühen Morgenstunden in Sulaymaniyah an.
Konvoi Richtung Bagdad
Im letzten Flug waren zehn Personen, wir landeten als einziges Flugzeug und die Koffer hätten wir direkt aus dem Laderaum nehmen und übers Rollfeld zum Terminal ziehen können. Aber wir mussten die 25 Meter mit dem Bus fahren. Internationale Vorschriften gelten eben auch hier. Beim durchblättern meines Passes, der inzwischen acht Seiten kurdische Visa aufweist (das sind andere, als für den Rest des Irak) bringt ein Lächeln auf das Gesicht des Beamten. „Welcome back, Mr. Lenze!“. Ich bekomme den Stempel und kann 15 Tage im Land bleiben, bis ich mich um ein richtiges Visum kümmern muss. In der Empfangshalle steht schon Kawa mit Weste und Sturmgewehr. Das braucht man hier nicht, aber es zeigt Status. Die Kontakte sind gut – er kann so bis zu mir. Mein Gepäck wird wegen Weste und Helm kurz inspiziert, alle sind höflich wie immer. Die Zollbeamten bedanken sich, dass ich über ihren Kampf berichte, wünschen mir einen sicheren Aufenthalt und schütteln mir die Hand zum Abschied. Das passiert einem hier durchaus oft. Draußen steht der gepanzerte Suburban mit Blaulicht und zwei Personenschützern sowie Kawas Mutter, die dolmetscht. Sie kann mehr Feinheiten und sprachliche Details rüber bringen als Kawa, der in Deutschland groß wurde. Wir fahren lange nach Süden, bis kurz vor Jalawla – dem Ende des kurdisch kontrollierten Gebietes. Hier steht die Kaserne von General Mahmoud Sangaw, welcher für die kommende Woche mein Gastgeber sein wird. Es ist bereits drei Uhr morgens, ich bin seit vierzig Stunden wach und seit knapp dreißig Stunden unterwegs. Die wichtigsten Fragen sind: Wie weit ist es zur Front? Also kann man in Ruhe schlafen oder sollte man alles griffbereit haben. Wir sind mehr als 10km weg von den Gebieten, in denen gekämpft wird. Eine klare Front gibt es erst ein Stück dahinter, also alles ok. Mich erwarten drei bis vier Stunden Schlaf auf einer Matte mit einer Wolldecke.
Wohnen in der Kaserne

Die Kaserne ist gut ausgestattet – also nicht für unsere, sondern für lokale Verhältnisse. Es gibt meterhohe Betonelemente, ähnlich denen der Berliner Mauer, ein Bagger kann Sand aufschütten, ein Generator liefert im Notfall Strom und es sind genug Soldaten und Waffen da, um alles zu verteidigen. Wir schlafen mit einigen Leuten zusammen in dem großen Raum, die anderen in einem Nebengebäude. Es gibt für alle eine Toilette sowie eine (kalte) Dusche. Zum Frühstück gibt es Schwarztee, Wasser, frischen Jogurt, frischen Honig (in der Wabe), Käse und frisch gebackenes Fladenbrot. Alles ist sehr lecker und bringt einen gut über den Tag. Die Peschmerga hier freuen sich immer über Besuch, wollen wissen ob ich für Hillary oder Trump bin und wie es mit der Flüchtlingskrise in Deutschland voran geht. In jedem Büro, in jeder Kaserne und selbst in den kleinen Shops laufen den ganzen Tag Nachrichten auf den Fernsehern. Das Wissen um die großen Themen der Welt ist gut. Nach dem Frühstück gucke ich mir das Gelände an und sehe den gepanzerten Humvee, den ich am Abend übersehen hatte. Daneben gibt es ungepanzerte Fahrzeuge mit Geschützturm. Einer hat ein Kaliber .50 Maschinengewehr, der andere einen 40mm Maschinengranatwerfer. Das ist alles gut, damit kann man leicht gepanzerte Fahrzeuge abwehren und ist selber im Zweifel vor MG Feuer bzw. im Humvee auch vor Granatwerfern und kleineren Minen sicher. Der General ist schon lange wach, begrüßt mich, gibt ein ausführliches Interview. Er holt seine Offiziere dazu, die diverse Details ihrer Arbeit erklären.
Sie beklagen, wie alle, die sehr schlechte Versorgungslage. Munition ist knapp, die können nicht richtig trainieren. Einige haben neue Zieloptiken, wollen diese aber nicht einschießen, weil sie die Munition dafür nicht verschwenden wollen. Andere Waffen werden umgebaut. So wird ein sowjetisches Dragunov Scharfschützengewehr mit dem Lauf eines US-Sturmgewehrs M4 versehen, um die kleinere, aber besser verfügbare Muniton nutzen zu können. Das ist etwa, als würde man die Front von einem US Sportwagen an das Heck eines russischen Geländewagens schweissen. Aber am Ende löst es das Problem. Schusssichere Westen und Helme sucht man bei den Soldaten hier vergeblich. Der Bagger vor der Tür gehört einem lokalen Bauunternehmer. Wenn die Soldaten an der Front sind, werden sie von Einheimischen mit Essen versorgt. Die Solidarität ist groß, alle wissen, dass nicht weniger als die Existenz ihres Volkes auf dem Spiel steht.
Eine richtige Front gibt es hier, nicht, aber immer wieder Angriffe bei Nacht. Sie sind auch bis Kirkuk gefahren, als der IS dort vor wenigen Wochen die Bevölkerung angegriffen hat um Sicherungsaufgaben zu übernehmen. Die richtige Front ist ein Stück weg, aber eigentlich gibt es zwei davon: Die zum IS und die zu Hashd-al-Shabi, besser bekannt als die „shiitischen Milizen“, auch wenn das nicht ganz korrekt ist.
Shiitische Milizen
Als im Sommer 2014 Mosul vom IS eingenommen wurde, brach die irakische Armee auseinander. Mir wurde damals vor Ort etwas von 50-80% Deserteuren berichtet. Der Irak drohte final im Chaos zu versinken. Um die Lage irgendwie stabilisieren zu können, sollte das Volk bewaffnete Milizen bilden, diese registrieren und dann auch von der irakischen Armee versorgt werden. Dieses Konstrukt nennt man Volksverteidigungseinheiten oder eben Haschd-al-Shabi. In Shingal wurden die Soldaten von Heider Schesho so registriert – das ist aber ein seltener Fall. Meist waren es shiitische Milizen, in denen oft auch iranische Soldaten dienten. Diese sind wiederum in einer Gegend, die von den Peschmerga verwaltet wird. Der Iran versucht diese Milizen zu nutzen, um legal Einfluss im Irak und vor allem in der autonomen Region Kurdistan zu gewinnen. Südlich von dort, wo ich war, standen die Haschd-al-Shabi, während westlich der IS war. Jeweils dahinter irgendwo soll die irakische Armee kommen. Vereinzelt haben die Haschd-al-Shabi den Peschmerga gegen den IS geholfen – jedoch nur, wenn der IS weniger als 36km an die iranische Grenze kam. Das Verhältnis zur Haschd-al-Shabi (auch „Hashish“) ist extrem schwankend. Man steht sich gegenüber, mag sich nicht, ab und zu gibt es aber Feuergefechte und die Milizen versuchen Gebietsansprüche geltend zu machen. Es ist schwer abzusehen, wie sich das entwickelt – im Zweifel aber nicht gut.
Einfaches Leben an der IS-Front

Der Weg zur Front ist anfangs noch unspektakulär. Man fährt durch die Orte Richtung Westen. Nach und nach sind die Häuser aber mehr zerstört oder fehlen komplett. Man sieht Menschen, die in den Ruinen wohnen und einem lächelnd zu winken. Auf einmal heißt es „Kamera aus! Vesteck‘ die mal eben“ – das habe ich in all den Jahren noch nie gehört. „Wir kommen zu den Hashis, aber müssen da nur kurz durch“. Wir fahren eine Abkürzung, die durch eine Haschd-al-Shabi Enklave führt. Sie haben eigene Soldaten hier, oft aus der iranischen Armee. Ihnen wird kurz erklärt, dass unser Konvoi inkl. Journalisten das Gebiet queren möchte und dass die Kameras aus sind. Sie sagen, sei in Ordnung, aber eben nichts filmen oder fotografieren. Dies ist quasi ein Vorposten der iranischen Armee, von denen immer mehr entstehen. Alle hier erklären mir, dass das bereits der nächste Konflikt ist. Der IS ist noch nicht ganz weg, der Iran ist noch ganz da. „Die wollen den Teheran-Damaskus Highway bauen, um ihre Waffen vor Syrien in Stellung zu bringen, damit sie die Amis ablenken können!“. Wir fahren nur etwa 250 Meter durch ihr Gebiet. Ich frage, warum es dann dieses Gebiet gibt und es nicht eingenommen wird – so mitten im Peschmerga Land. Diese „Hashis“ haben keine Absicht zu expandieren, das Gebiet ist voller Zivilisten, man akzeptiert sich gegenseitig und respektiert die Regeln, wie zum Beispiel, dass sonst nicht fotografiert wird. Somit gibt es keine Probleme. Alles andere würde Tote auf beiden Seiten bedeuten und da hat niemand etwas von. Eine wirre Welt für mich. Die Grenze zwischen Freund, Neutralem und Feind ist immer unklarer.
An einem Zwischenstop bekommen wir letzte Informationen, sollen Weste und Helm anziehen. Dann geht es zur eigentlichen Front.
Mitten im Nichts erhebt sich ein etwa fünfzehn Meter hoher Erdhügel aus der kurdischen Wüste. Sieht etwas aus, wie eine große Sandburg. Oben drauf die kurdische Fahne und ein paar Menschen, daneben ein rund drei Meter hoher Erdwall. Nach hundert Meter der nächste Hügel und der nächste und immer so weiter. Wir fahren den Hügel hoch, der oben ein Plateau von vielleicht zehn bis fünfzehn Metern Durchmesser hat. Der Rand ist etwas höher, dass er Schutz bietet. Aus einfachen Betonblöcken und Plastik sind kleine Verschläge von fünf Quadratmetern errichtet und es gibt eine Feuerstelle. Hier verbringen etwa zehn Leute eine Woche. Geschlafen wird auf Pappe in den Verschlägen, dazu gibt es eine Wolldecke. Wenn die Leute aus dem Nachbarort gekocht haben, kommen sie rüber und bringen Essen. Ich stehe in einer neuen Weste mit Helm da, habe die ballistische Sonnebrille auf und die teure Kamera in der Hand und neben mir kommt eine vermutlich 70 jährige Frau auf einem Moped mit einer Gullaschkanone an, teilt Essen aus und setzt ihren Weg fort. Manchmal komme ich mir hier vor, wie in einem schlechten Film und denke mir: Wann ist diese Welt eigentlich so kaputt gegangen?
Die Soldaten freuen sich über jeden Besuch und wir müssen erst mal alle Selfies miteinander machen. Sie beklagen sich ebenfalls über die schlechte Ausstattung und dass sie kaum Geld bekommen. Nicht alle sind bezahlte Soldaten, es gibt auch freiwillige. Kawa gehört zum Beispiel zu den Freiwilligen. Er schützt mich die ganze Woche mit seinem Leben, ist ein Jahr im Einsatz und muss noch seine Ausrüstung selber bezahlen. Die Soldaten erhalten ca. 400 us$ Sold pro Monat. Aber die kurdische Regionalregierung (KRG) muss derzeit 2.5 Mio Flüchtlinge versorgen, den Krieg gegen den IS finanzieren und der Ölpreis ist im Rekordtief – an sich sind sie pleite und kämpfen nur noch ums wirtschaftliche Überleben. Der Rest der Welt sieht weg. Praktisch erhalten die Peschmerga alle 2-3 Monate ein Gehalt. Also leben sie derzeit oft von weniger als 200us$ pro Monat. Aber sie wollen sich nicht beklagen über die Leute im Land. Alle ziehen an einem Strang und es schweißt sie zusammen. Enttäuscht sind sie von der Welt. Sie führen stellvertretend den Kampf gegen den IS, filtern die Terroristen aus den Flüchtlingen, versorgen die Flüchtlinge so gut sie es irgendwie können aber erhalten kaum Unterstützung.
Wir fahren weitere Stellungen ab, die Geschichten sind die gleichen. Aber die Leute freuen sich wahnsinnig, wenn man vorbei kommt, es motiviert sie und man kann Ihnen den Respekt zollen, den sie eigentlich verdienen. Sie sind die vergessenen Helden dieses Krieges. Wenn der Kampf einmal vorbei ist, wird ihr Sold vermutlich nicht nachgezahlt werden können. Sie erhalten keine Auszeichnung, die Gefallenen stehen auf keiner steinernen Tafel. Sie werden wieder als Maler, Verkäufer oder Lehrer arbeiten und die Erinnerung an ihren Kampf wird im Dunst der Geschichte untergehen.
Ako – Roadtrip with a Hero

Wir fahren wieder etwas ins Hinterland zu einer größeren Kaserne. Hier sehe ich den zerschossenen 7er BMW, den ich von den Fotos kenne. Schnappe die Kamera renne hin, will Ako die Hand schütteln. Er steht ganz schüchtern daneben, weiß kaum wie ihm geschieht. Sofort bildet sich eine Traube von Menschen um ihn. Alle wollen ihm die Hand geben, ihn umarmen, ein Selfie mit ihm, das Auto anfassen, was im ganzen Land zur Legende wurde. Er lächelt verlegen, aber weiss nicht recht, mit dem Personenkult umzugehen. „Ich habe doch nur getan, was eben nötig war. Das hätte jeder andere auch gemacht…“ – und er meint das total ernst.Er sieht es als seine Pflicht an, als Mensch denen zu helfen, denen es schlechter geht. Besonders sei das nicht.
Ako ist zwei Jahre jünger als ich, aber ein erfahrener Kämpfer im Kampf gegen den IS. Er hatte früher mit den US-Truppen in Bagdad gearbeitet, dort hat er auch den 7er BMW gekauft, der 1996 in Deutschland von BMW hergestellt und gepanzert wurde. Der Ausstattung nach wurde er vermutlich von der Bundespolizei beim Personenschutz benutzt. Er nennt diesen Wagen „Siliposch“. Die Stoßdämpfer sind am Ende, die Klimaanlage leckt und die Bremsen sind runter. Ako fährt den Wagen dennoch mit 200km/h über die Landstraßen und muss dabei immer am Einschußloch direkt vor seinem Kopf vorbei gucken. Er bedient nebenher zwei Telefone, die permanent klingeln oder raucht. Dennoch hat man nicht das Gefühl, dass er unsicher fährt. Der Wagen hat achtzehn Einschußlöcher von Sturmgewehren – durchgegangen ist aber nichts. Das sind richtige Kriegsschäden aus einem üblen Feuergefecht. So etwas an einem Zivilfahrzeug hatte ich bisher nie gesehen. Der Humvee in der Kaserne hat zwei sichtbare Einschüsse, der gepanzerte Suburban einen.

Ako und sein Freund Abbas sind mit dem Wagen nach Kirkuk gefahren, als der IS dort vor wenigen Wochen mit Sleepern und einem Kommando versucht hat Regierungsgebäude einzunehmen. Auf den Straßen lagen Verletzte und Tote, die nicht sicher geborgen werden konnten. Die Peschmerga verfügen kaum über gepanzerte Fahrzeuge, ebensowenig über ausgebildete Mediziner. Ako hat nie ein entsprechendes Fahrertraining absolviert – hat aber ganz praktische Erfahrung, wie man in so Situationen agiert. Er brachte den Wagen immer in die sicherste mögliche Position für die Opfer und sein Freund Abbas zog sie in das Auto. Man kann pro Tour 3-4 Verletzte bergen – an eine Versorgung ist nicht zu denken. Durch den Kugelhagel fuhr er sie in die Notaufnahme, drehte um und holte die nächsten. Wie oft er gefahren ist und wie viele Leute er rausgeholt hat, kann er nicht sagen. Das Krankenhaus vermeldete aber 75 Menschen, die die beiden gerettet haben. Sie müssen also mehr als 20 Mal wieder und wieder bis in Sichtweite des IS gefahren sein, wohlwissend, dass beide jeden Moment ermordet werden können. Aber das Leben der vielen Opfer stellten sie ganz selbstverständlich über ihres. Sie sind beide freiwillig unterwegs, erhalten keinen Cent, haben keine Krankenversicherung, keine gesicherten Mahlzeiten und wissen nicht, was die Zukunft bringt.

Mit mir passiert das, was ich schon so oft erlebt habe – aus diesen anonymen Leuten auf er anderen Seite der Headline werden Menschen, die ich im Arm gehabt habe, mit denen ich gesprochen habe und mit denen ich Tee getrunken habe. Langsam realisiere ich, dass dies unser erstes und letztes Treffen gewesen sein könnte und ich habe wahnsinnige Angst um sie. Früher war auch diese Angst etwas abstraktes für mich, dann kamen die ersten Toten im Freundeskreis und irgendwann werden es zu viele. Alleine dieses Jahr sind mehr als zehn Menschen, die ich kannte, an der IS-Front gestorben.
Sein Auto ist im bemitleidenswerten Zustand und müsste dringend repariert werden – oder eben in ein Museum und er bräuchte ein neues. Gleichzeitig mit mir ist aber auch Fidelis Cloer in der Gegend. Seit siebenundzwanzig Jahren entwickelt, baut und verkauft er die sichersten zivilen gepanzerten Fahrzeuge der Welt. Bei ihm habe ich im April meine Zertifizierung zum „armored vehicle secure driver“ und „life safer“ gemacht. Und für ihn ist das, was er tut, kein Job, bei dem es einfach um Geld geht, sondern eine Passion. Er hat fast jeden Krieg der vergangenen Dekaden selber gesehen und weiß, um was es im Leben wirklich geht. Er kennt die Geschichte von Ako natürlich auch und sagt, dass er sofort rüber kommt um sich der Sache anzunehmen. Er ist aber 250km weit weg, was hier eine ziemliche Distanz ist. Mich erreicht zur gleichen Zeit die Nachricht, dass mein Rückflug storniert wurde – ich kann mich aber nicht drum kümmern und delegiere das Problem zu Helena nach Antalya, welche aus der Branche kommt und zu welcher ich im Anschluss eh fliegen sollte, um dort mit Diplomaten und Leuten aus dem Sicherheitsbereich zu sprechen. Sie organisiert einen neuen Flug über Erbil. Der Plan ist also, mich in Erbil abzuwerfen und dabei Fidelis aufzunehmen und dann wieder zurück zu Ako zu fahren. Ein 500km Roundtrip, der vermutlich 10h dauern wird. Diese Zahlen sind für die Entscheidungsfindung aber wenig relevant – allen ist klar, dass es so gemacht wird. Also brechen wir auf. Auf dem Weg besuchen wir aber noch ein Flüchtlingscamp mit irakischen Flüchtlingen.
Flüchtlinge aus dem Irak und Syrien

Wer aus dem Irak nach Kurdistan (Irak) kommt, ist korrekterweise kein Flüchtling („Refugee“) sondern ein Binnenflüchtling (IDP „internally displaced people“). In Deutschland wird oft berichtet, in Kurdistan (Irak) werden die arabischen Flüchtlinge vertrieben werden, ihre Häuser gesprengt usw. – da hier hunderttausende arabische Flüchtlinge ankommen und versorgt werden fragt man sich immer, ob die Leute, die so etwas verbreiten, je hier waren. Die Headlines stimmen natürlich nicht. Unterm Strich ist das aber egal. Ihre Geschichten sind die gleichen. Der IS kam, sie mussten fliehen, haben alles Hab und Gut und einen Teil der Freunde und Familie verloren. Nun wohnen sie Wochen, Monate, Jahre in den Camps. Die Versorgung ist ok. Es gibt genug Lebensmittel, eine Schule, eine Wäscherei und Fernsehen. Aber ein gutes Leben hat man davon nicht. Es ist langweilig und man tritt auf der Stelle. Das Camp ist teilweise selbstorganisiert. Die Leitung besteht zu 75% aus geflüchteten Menschen, die meisten Lehrer ebenfalls. Ich treffe einen Krankenpfleger aus Italien, der für die NGO „Emergency“ arbeitet. Ein Interview darf er nicht ohne Weiteres geben, aber wir unterhalten uns abseits des Mikrofons über seinen Job und die Lage hier. Wir fragen uns gegenseitig, wieso man gerade so etwas macht und merken, wie unsinnig diese Frage doch ist. Wir beide machen unsere jeweilige Arbeit hier, weil wir es einfach für nötig und richtig halten.
In diesem Camp gibt es auch jede Menge unbegleiteter Kinder, oft aus Fallujah. Von dort bis zur sicheren kurdischen Zone sind es, je nach Route, 150 bis 200km. Ich frage, wie die Kinder dahin kommen. Also, wer sie mitnimmt bzw. ob die Eltern auf der Flucht gestorben sind. Ein zehnjähriger erzählt mir, er war der älteste, der noch gelebt hat. Also hat er „die kleinen“ genommen und sich einem Treck anderer Leute angeschlossen, die nach Kurdistan wollten. Sie sind rund eine Woche gelaufen, bis sie am ersten Checkpoint der Peschmerga ankamen und versorgt wurden.
Wie überlebt man so eine Flucht? Gerade die Kinder bekommen häufig Essen oder Trinken von Einheimischen. Manche Kinder werden auf der Strecke schon aufgenommen und bleiben irgendwo da. Während das IS Gebiet für sie tödlich wäre, lassen die Haschd-al-Shabi sie normalerweise einfach passieren. Einige sterben auf der Flucht, einige sogar wenn sie bereits in Sicherheit sind, weil man sie nicht mehr retten kann.
Während ich mit toten Soldaten inzwischen gut umgehen kann, habe ich einmal miterlebt, wie ein solches Kind direkt vor mir gestorben ist, weil man ihm einfach nicht mehr helfen konnte. Da hört es dann mit journalistischer Distanz und allem, was man sich in den westlichen Redaktionen am Schreibtisch gerne einredet, einfach völlig auf. Da kann man einfach nicht mehr.
Wie die Kinder aber immer noch breit lächelnd da sitzen und mit ihren Stöcken und einfachen Bällen spielen können, werde ich nie verstehen. Sie strahlen eine solche Zufriedenheit und eine solche Lebensfreude aus, wie man es aus Deutschland kaum gewohnt ist.
Wie man wieder ins Leben kommt

Wir fahren weiter, um noch spät in der Nacht Erbil zu erreichen. An den Checkpoints Richtung Norden fängt das Zuständigkeitsgerangel an. Für Panzerfahrzeuge braucht man eine Sondererlaubnis, um als Soldat einer anderen Gegend bewaffnet durch den Checkpoint zu kommen auch. Ich genieße den Schutz aller Seiten, könnte also wie ein Staffelstab an einen anderen Konvoi übergeben werden – wäre aber unnötige Arbeit. Ich zeige meine Reisedokumente, mit denen ich üblicherweise freies Geleit und Schutz auch in militärischen Sperrbereichen haben. Der Offizier im Checkpoint lässt sich das kurz bestätigen und erlaubt die Weiterfahrt, bittet uns aber nicht in den Sicherheitsbereich des Flughafens einzufahren. Das ist ja kein Problem. Er bedankt sich dafür, dass wir alle da sind und verabschiedet uns mit einem Lächeln.
Wir kommen im fünf Sterne Hotel an, futtern uns am Buffet durch. Die Personenschützer in ihren kriegserprobten Klamotten, Kawa mit Magazintaschen und Weste sowie den leeren Waffenhalterungen, während vor uns ein kubanisches Trio Pop-Songs singt und um uns herum Armani Anzüge stehen. Auf dem Tisch steht Champagner-Crème mit Granatapfelkernen und Whiskey für 250 us$ die Flasche – mehr als mein Personenschützer im Monat verdient.
Es ist einfach so unglaublich, wie dicht diese Welten zusammen liegen. Wieder ist es 3:00 Uhr morgens, wieder stehen mir noch rund 15h bevor, bis ich ins Bett kann. Ich verabschiede mich schnell von allen, nehme ein Taxi zum Flughafen und versuche meinen Kopf zu sortieren. Vor acht Stunden stand ich an der IS Front, in acht Stunden werde ich die Hand des Konsuls schütteln und mit Blick aufs Meer in Antalya über die Sicherheitslage sprechen.
Mich macht dieser Bruch immer noch fertig, aber ich habe mich im Großen und Ganzen daran gewöhnt. Die Umstellung geht immer schneller, aber die Frage in meinem Kopf bleibt: Was ist mit dieser Welt eigentlich kaputt!? Das kann doch alles nicht sein.
Während ich auf das Meer blicke, sitzt Fidelis bei Ako, schriebt das Gutachten zum Fahrzeug und schenkt Ako eine schussichere Weste und einen ballistischen Helm.