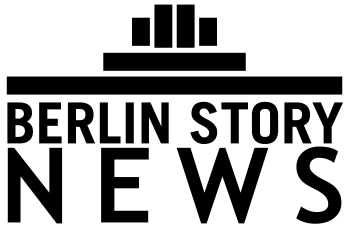Mit Akustikkoppler von einer verbotenen Konferenz in der Sowjetunion berichtet – 1989
Wie berichtet man als freier Journalist vor dem Fall der Berliner Mauer tagesaktuell aus Lettland, damals Sowjetunion, wenn die Konferenz verboten und von Panzern umstellt ist, wenn das einzige funktionierende Telefon in der Polizeistation steht und wenn es kein Fax gibt? Easy. Freunde dich mit dem lettischen Polizeichef an, der die Russen hasst – und du brauchst einen Akustikkoppler. Was ist das?
🔊 Diesen Beitrag als Podcast hören 🔊

Der Akustikkoppler wandelt die digitalen Daten eines Laptops in analoge Töne um, die wie ein Fax piepen. Ein Kabel wird in die serielle Schnittstelle des Computers gesteckt, am anderen Ende wird der Telefonhörer in zwei Saugnäpfe gedrückt.

Das Kabel für die serielle Schnittstelle des Computers.
Fest drücken, damit möglichst wenig Umgebungsgeräusche stören – und dann hoffen, dass die analoge Telefonverbindung einigermaßen gut ist. Über den Telefonhörer wurde gesendet und empfangen. Die Übertragungsraten lagen zwischen 300 und 2.400 Bit/s. Heute reden wir von einem Gigabit, tausende Male schneller. Damals hätte es eine Stunde gedauert, ein Lied als mp3 herunterzuladen. Aber mp3 gab es noch nicht.

Ein übliches Wählscheibentelefon, Hörer und Akustikkoppler. „Ahhh, ein Modem, aber analog“, sagt ein Besucher im Berlin Story Bunker.
Die Wahrscheinlichkeit, dass die Russen irgendwie in der Leitung hängen, dass jemand mithört, war relativ groß. Deshalb war das Telefonieren nicht so angesagt. Es ging auch darum, die lettischen Polizisten zu schützen. Das Piepsen hätte man hören können, aber das war keine sehr verbreitete Technik. Hinzu kam, dass die Kolleginnen und Kollegen auf der anderen Seite, also bei der taz, nicht auf telefonische Berichterstattung eingestellt waren. Es gab kein Aufnahmegerät und niemand konnte Stenographie.
Das war zwanzig Jahre zuvor beim Springer-Verlag anders: Als Benno Ohnesorg am 2. Juni 1967 von dem Polizisten und Stasi-Spitzel Karl-Heinz Kurras erschossen wurde, gab der Morgenpost-Journalist Michael Müller seine fortlaufenden Berichte per Telefon in die Redaktion durch. Eine Sekretärin stenografierte mit. Doch Müller musste sich in der Kneipe mit Telefon immer wieder anstellen, denn er war nicht der einzige Journalist.
Zurück nach Lettland. Eine lettische Umweltgruppe hatte im Juni 1989 zu einer Konferenz über die Verschmutzung der Ostsee eingeladen. Als freier Journalist muss man immer dorthin fahren, wo die fest angestellten Korrespondenten nicht sind. Außerdem hatte ich das Gefühl, dass es um mehr ging. Etwa hundert Teilnehmer waren zur Ostseekonferenz gekommen, die meisten aus Westeuropa, allein über dreißig aus der Bundesrepublik, und zwei von der Arche aus Ostberlin. Einer der beiden, Matthias, erzählte mir, dass er sich wunderte, dass er manchmal zu Konferenzen außerhalb der DDR fahren durfte, also ein Visum und eine Genehmigung bekam, manchmal aber auch nicht, ohne dass es für ihn irgendeinen Sinn machte. Es dauerte nicht lange, bis die Mauer fiel und sich nach der Öffnung der Stasi-Akten herausstellte, dass der andere, Falk, der Stasi-Spitzel war. Nur wenn er Matthias begleiten konnte, gab es die Ausreise.

Die Fahne Lettlands wird am 20. Juni 1989 am Tagungsort, dem Schloss Edole, gehisst. Sie war zuvor in der Kirche geweiht worden und wurde in einer Prozession von jungen Leuten in traditioneller Tracht getragen. Eine massive und mutige Provokation der lettischen Umwelt- und Unabhängigkeitsbewegung in der hochgerüsteten Sowjetunion.
Am 4. Mai 1990 erklärt sich Lettland für unabhängig. Am 18. März 1990 hatte die Lettische Volksfront 131 der 199 Sitze im Parlament errungen, obwohl der lettische Bevölkerungsanteil nur (noch) 52 Prozent betrug. Auch viele Russen in Lettland wollten also die Unabhängigkeit.
Dass es nicht nur um die Ostsee ging, wurde gleich zu Beginn deutlich. In der Kirche war eine lettische Fahne gesegnet worden, die in einem Festzug mit jungen Leuten in lettischer Tracht zum Tagungsort gebracht und feierlich gehisst wurde. Mehr konnte man die Russen eigentlich nicht provozieren. Und doch: Denn der Ort, zu dem eingeladen worden war, galt als russisches Sperrgebiet. Das erfuhren die Teilnehmer erst im Laufe der Zeit. Wer sollte auch auf die Idee kommen, dass es so etwas gibt? Weit und breit waren keine Kasernen oder Raketensilos zu sehen.

Damals, 1989, war Edole wie eine Jugendherberge. Heute kann man bei Booking als edoles-pils buchen. „Das Ēdoles Pils empfängt Sie in einem Schloss aus dem 13. Jahrhundert mit Seeblick und einem Park voller Spazierwege. Sie wohnen in Ēdole in der Region Kurland, 42 km von Ventspils entfernt“.
Doch die Provokationen der Letten gegenüber der sowjetischen Führung in Riga und Moskau gingen noch weiter. Das Innenministerium verbot die Konferenz, der örtliche (lettische) Polizeichef wurde aufgefordert, das Verbot zu überbringen. Er tat dies pflichtbewusst, ließ aber durchblicken, dass es keine konkreten Anweisungen zur Umsetzung des Verbots gegeben habe. Die Busse des Innenministeriums, die die Konferenzteilnehmer abholen sollten, fuhren unverrichteter Dinge wieder ab. Eine Rundfahrt zu ökologischen Hotspots wurde von Fahrzeugen der örtlichen Polizei mit Blaulicht begleitet, damit der Bus auch wieder zum Tagungsort zurückfahren konnte. Wie gefährlich war das alles? Schwer zu sagen. Einerseits durfte das Innenministerium eigentlich nicht das Gesicht verlieren und hätte sich durchsetzen müssen, andererseits waren so viele westliche Ausländer dabei und außerdem waren alle Signale, die aus Moskau kamen, unklar. Das war wohl auch der Grund, warum das Verteidigungsministerium die Panzer in Bewegung setzte, sie aber weit weg vom Tagungsort hielt.
Die Situation erinnerte mich ein wenig an die DDR: Umweltgruppen und politische Opposition im Allgemeinen waren ein Haufen. Aber die lettischen Grünen kamen mir eher national oder nationalistisch vor. Erst in den Interviews wurde mir klar, dass Stalin noch 1949 Zehntausende Letten nach Sibirien deportieren ließ, dass ein großer Teil dort umkam, dass Lettland brutal russifiziert wurde. In Westeuropa hat man das in der Nachkriegszeit nicht so wahrgenommen.

Der Sony Walkman Professional in Sendequalität. Eine teure Anschaffung, aber deutlich komfortabler als das Uher Report Gerät von früher. Dazu das klassische Sennheiser-Mikrofon MD421. Gut für Radio, aber auch für die Beatles und Rolling Stones. Insgesamt habe ich zwölf Kassetten aufgenommen, Interviews und O-Töne.
Meine Aufnahmen mit Interviews als Grundlage für Radiobeiträge füllen zwölf Kassetten. Das war auch heikel: Einerseits ging es darum, zu vermitteln, was die Letten ausdrücken wollten, wie sie die Umweltzerstörung durch die russische Industrie sahen. Aber sie arbeiteten auch daran, wieder ein unabhängiger Staat zu werden, frei von Russen. Hätte man mir diese Bänder weggenommen, hätte das die Interviewpartner in große Gefahr bringen können. So etwas ist mir in den 1970er Jahren passiert, als der britische Geheimdienst mir die Aufzeichnungen von Interviews mit Iren wegnahm, die gegen die britische Besatzung in Nordirland kämpften. In Lettland hatte ich jedoch Glück und konnte die Bänder ohne Probleme außer Landes bringen.
Der Polizeichef war in meinem Alter und hatte ebenfalls drei Kinder. Wir sind zusammen auf einem der wunderschönen Seen gerudert und geschwommen. Auf den Feldern roch es nach frischem Heu. Auf den Waldlichtungen duftete es nach wilden Erdbeeren. Ich konnte verstehen, dass Bismarck gerne vom Schloss Edole aus auf die Jagd ging. 1989 war es eher eine Jugendherberge. Heute befindet sich ein Hotel in dem wunderschön renovierten Anwesen.
Ich weiß nicht mehr, warum ich immer nach 17 Uhr mit meiner ganzen Ausrüstung auf die Wache kommen musste. Laptop, Kabel, Akustikkoppler. Der Chef wählte persönlich, dann konnte ich übertragen und beobachtete misstrauisch das grüne Blinken. Blinkte es rot, musste die Übertragung wiederholt werden. Manfred Kriener und Gerd Rosenkranz von der Öko-Redaktion der taz freuten sich über die Exklusivberichte. Sie waren so begeistert, dass ich anschließend bei der taz angestellt wurde. Ich Glücksschwein bin von Münster nach Berlin gezogen. Aber: Nach drei Monaten hieß es in der Frauenredaktion, die Parität sei noch nicht erreicht, ich müsse gehen. Drei Kinder zu versorgen? Kein Thema. Feminismus ging vor. Aber ich hatte schon einen Job im Europäischen Parlament und konnte fast unmittelbar nach dem Mauerfall im Frühjahr 1990 eine Bestandsaufnahme der Umweltsituation in der DDR machen. Mein Kontakt zu Matthias und über ihn zu den Umweltgruppen in der DDR war die Basis für diese Rundreise.
Der Polizeichef und die Organisatoren der Konferenz verstanden sich gut, oder vielleicht kannten sie sich und das Ganze war ein abgekartetes Spiel gegen die Russen. Eine Rundfahrt zu Umweltsündern konnte die Gruppe zunächst nicht antreten, dann doch, und zwar mit Polizeieskorte und Blaulicht, damit die Busse zum Tagungsort zurückfahren konnten. Eine weitere Provokation der lettischen Polizei gegen die sowjettreue Führung in Riga. Wie ein solcher Akt des Ungehorsams enden würde, war nicht abzusehen. Wie sich später herausstellte, war der Konferenzort weiträumig von russischen Panzern umstellt. Weder der Polizeichef noch die Organisatoren wollten uns mit diesem Wissen beunruhigen. Worum es bei der Konferenz wirklich ging, kann man in meinen fünf Beiträgen für die taz nachlesen, hier unten.
Was macht man mit so einem Akustikkoppler? Nur ein Messie hebt so etwas auf. Typen wie ich. Was für ein Glück. Denn heute ist genau dieser Akustikkoppler ein Exponat im Museum „Deutschland 1945 bis heute“ im Berlin Story Bunker. Es geht um die Zeit, als in den 1970er Jahren die neuen Medien entstanden: Stadtzeitungen, die „Informationen zur Verbreitung unterbliebener Nachrichten“, der Amos im Ruhrgebiet und unabhängige Verlage wie Elefanten Press sowie schließlich die taz. Vor dieser Vitrine stehen jünger Besucher ziemlich lange. Es dauert, bis sie verstehen, wie diese Technik funktionierte.

Der Autor in Edole mit Laptop, eine Aufnahme des Fotografen Maris Bogustovs, der die Konferenz begleitete.
Vier Berichte von der Baltic Sea Conference im Juni 1989 aus Lettland/Sowjetunion für die taz sowie ein weiterer Bericht über die Lage der Umwelt

Dienstag, 20. Juni 1989 aus Ēdole, Lettland, Sowjetunion
Eine Delegation von 35 deutschen Umweltschützern in der Sowjetunion steht vor der Ausweisung vom Konferenzort. Der lettische „Club zur Verteidigung der Umwelt“ lud zu einem internationalen Treffen über die Ostsee ein, dem ersten wirklichen Umwelt-Basistreffen. 35 (West-) Deutsche kamen, dazu Umweltschützer aus Schweden, Finnland, Holland, den Vereinigten Staaten, der DDR und den anderen baltischen Staaten.
Eine Woche nach dem Besuch Gorbatschows in Deutschland, zwei Tage, nachdem eine Delegation aus Riga in Bremen war, kommt es in Lettland zum Eklat.
Dabei fing alles so gut an: Vor einem Jahr trafen sich Aktivisten der „Aktionskonferenz Nordsee“ aus Bremen in Leningrad [heute wieder St. Petersburg] mit dem lettischen Umweltclub. Wegen der deutsch-sowjetischen Morgendämmerung rechnete man sich beste Chancen für die Konferenz aus. Ob es allerdings wirklich klappen würde, stand bis vor wenigen Tagen in den Sternen. Erste Schwierigkeiten traten mit den Visa auf. Sie wurden so kurzfristig erteilt, dass sie direkt von der sowjetischen Botschaft zum Flughafen gebracht werden mussten.
In Leningrad angekommen war nicht klar, wie es weitergehen würde. Ein Bus brachte die Gruppe in der Nacht zu Montag nach Riga. 500 Kilometer entlang der baltischen Küste, 500 Kilometer Demonstration in Sachen Umweltzerstörung: Kiefern und Fichten, die ihre Äste hängen lassen, ausgenadelte Bäume, verkürzte Kronen: alles Zeichen für Säure in der Luft und im Regen. Die Schlote der chemischen Industrie qualmten wie in einem Propagandafilme von Sergej Eisenstein, in dem Kapitalisten mit Zylindern auftreten und die Arbeiterklasse hungert.
In Riga angekommen stand immer noch nicht fest, ob die internationale Konferenz des Clubs zur Verteidigung der Umwelt in dessen Tagungshaus etwa 150 Kilometer von Riga entfernt in Ēdole stattfinden durfte. Die Genehmigung durch die Behörden war seit Monaten beantragt. In Riga und in dessen Badeort Jurmela machen sich selbst hohe Kader aus Partei und Verwaltung gegen den Dreck im Baltikum stark. Der Bürgermeister wies auf den Rückgang des Tourismus hin, der zu ernsthaften ökonomischen Folgen führe. Die meisten großen Städte haben keine oder nicht funktionierende Kläranlagen, die Bakterienverschmutzung der Ostsee liegt hier zwanzigmal über Normal, baden ist wegen der Infektionsgefahr schon lange verboten.
Am Tagungsort in einem alten Schloss des deutschen Barons Bär hatten die Veranstalter inzwischen für mehr als hundert Teilnehmer alles vorbereitet – keine Kleinigkeit ohne staatliche Hilfe. Denn ohne den Staat sollte alles laufen. Es ist dies die erste Konferenz, zu der „nur“ eine Umweltorganisation einlädt. Kleinere Treffen gab es im vorigen Jahr auf Einladung des sowjetischen Schriftstellerverbandes und in diesem Jahr zwischen Spitzen der Grünen und der KPdSU bei Gorleben. Diesmal ist die Basis dran.
Auf dem Weg zu Tagungsschloss wurde der Bus der deutschen Delegation von der Polizei vorübergehend gestoppt, weil es sich um ein für Ausländer noch nicht genehmigtes Gebiet handele. Sechs Störche auf dem benachbarten Feld beobachteten diese Aktion.
Der Konflikt zwischen den sowjetischen Betonköpfen in Riga und der ökologisch orientierten Reformfraktion spiegelt sich in diesen ganzen Hemmnissen wider. Denn im Hintergrund der Umweltkonferenz steht die Forderung nach Unabhängigkeit der baltischen Staaten, die nach dem Hitler-Stalin-Pakt zur Sowjetunion kamen und jetzt Autonomie fordern. Sie berufen sich auch auf die vorige Woche in Bonn zwischen Gorbatschow und Kohl unterzeichnete Vereinbarung, die das Selbstbestimmungsrecht der Völker unterstreicht.
Der Bus durfte nach einigem Hin und Her die Polizeikontrolle passieren, aber jetzt, am ersten Tag der Konferenz, ist es soweit: Das lettische Innenministerium fordert das Ende der Konferenz. Während ich hier berichte, macht sich unten im Haus die Polizei breit. Unter ständiger Spannung kam die Konferenz zwar in Gang, aber konzentrieren kann sich hier unter diesem Damoklesschwert des drohenden Verbots niemand.
Wieland Giebel

Mittwoch, 21. Juni 1989
Mittwoch, 21. Juni 1989
Die Ostseekonferenz bei Riga in Lettland ist heute verboten worden. Der örtliche Polizeichef habe diese Nachricht aus dem Innenministerium überbringen müssen. Er habe aber keinen anderen Auftrag, als dies mitzuteilen. Obwohl bereits Busse des Ministeriums vorfuhren, um die Teilnehmer der Umweltschutzkonferenz abzuholen, wird die Konferenz nach einem Beschluss der mehr als hundert internationalen Gäste aus Skandinavien, der DDR und der Bundesrepublik fortgesetzt.
Einmal mehr werden die Widersprüche innerhalb des Parteiapparates deutlich: Der lettische Ministerrat weigert sich, auf seiner heutigen Sitzung das Problem dieser Konferenz zu diskutieren. Im Fernsehen ist es jedoch Thema Nummer eins. Es geht darum, dass das Tagungshaus des „Clubs zur Verteidigung der Umwelt“ in einer Zone liegt, die noch nicht für Touristen geöffnet ist. Viele dieser Zonen sind inzwischen geöffnet, die militärischen Projekte längst bekannt und für die Umweltschützer ohne Bedeutung. Aber im lettischen Ministerrat sitzt die alte Garde, die Gorbatschows Perestroika Knüppel zwischen die Beine wirft, wo sie nur kann. Das Problem mit dem Tagungsort ist nur vorgeschoben. Das machte auch der örtliche Polizeichef deutlich, der sich vorbehaltlos hinter die Ziele der Konferenz stellte, mit den Gästen wie auf einer politischen Veranstaltung diskutierte und keine Bereitschaft zeigte, irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen. Er sieht sich als letztes Glied in einer Reihe von unangenehmen Auseinandersetzungen zwischen Reformern und dem konservativen Ministerrat. Für die Konferenzteilnehmer bestehe keine Gefahr. Allenfalls könne es in Zukunft Probleme mit Visa geben.
Der Ministerrat lasse sich nicht auf Diskussionen ein, weil die Umwelt- und die Unabhängigkeitsbewegung eng miteinander verbunden seien. Industrielle Umweltverschmutzung wie zu Zeiten des Frühkapitalismus, sagen die baltischen Umweltschützer, habe nur damit zu tun, dass alle Entscheidungen in Moskau und von Russen getroffen werden.
Unabhängigkeit bedeutet für die Umweltbewegung auch die Möglichkeit, über die eigenen Ressourcen und die eigene Industrie zu bestimmen. Die Polizei hat inzwischen signalisiert, dass sie sich um die Legalisierung des Aufenthalts der Gäste in diesem abgelegenen Teil des Baltikums kümmern will. Ob sie das überhaupt kann, ob sie dafür formal zuständig ist, wird hier eher bezweifelt. Der Kampf zwischen zwei Linien in der Partei wird offenbar mit harten Bandagen geführt.
Letzter Stand am Donnerstag, 22. Juni 1989: Eine Rundreise der Konferenzteilnehmer zu ökologisch interessanten Orten in Lettland muss abgesagt werden. Die örtliche Polizei garantiert gegen den erklärten Willen des lettischen Innenministeriums die weitere Durchführung am Tagungsort. Sollten die Delegierten jedoch den Konferenzort verlassen, ist nicht sicher, ob sie zurückkehren können.
Wieland Giebel
Wieland Giebel

Freitag, 23. Juni 1989 an die taz
Die Ostseekonferenz bei Riga läuft trotz Verbots weiter. Örtliche Polizei verweigert das Eingreifen
Die internationale Konferenz zum Schutz der Ostsee bei Riga wird trotz eines Verbots des [sowjetischen] lettischen Innenministeriums fortgesetzt. Die Teilnehmer aus den skandinavischen Ländern, der DDR, der Bundesrepublik und den baltischen Staaten beschlossen gestern, das Verbot zu ignorieren. Der Landrat des Kreises Kuldiga und die regionale Polizei versicherten den Konferenzteilnehmern, dass es vor Ort keine Einschränkungen geben werde. Die Polizei werde nicht eingesetzt und die Verwaltung stehe hinter den Zielen der Umweltschützer, erklärten die beiden Verantwortlichen. Sie diskutierten mehr als zwei Stunden mit den Konferenzteilnehmern. Probleme könnte es allenfalls geben, wenn die ausländischen Gäste demnächst wieder Visa für die UdSSR beantragen. Busse des Innenministeriums, die die Konferenzteilnehmer abholen sollten, fuhren unverrichteter Dinge wieder ab. Eine für heute, Freitag, geplante Rundreise zu ökologisch sensiblen Punkten in Lettland wurde abgesagt, weil die Kreisverwaltung nicht zusichern konnte, dass eine Rückkehr zum Tagungsort möglich sei.
Der Chef der Kreisverwaltung, Alexander Gudmann, gab Moskau die Schuld an der ökologischen Misere Lettlands. Von den Exportgewinnen bleibe zu wenig im Land, um die Wirtschaft weiterzuentwickeln und die Landwirtschaft auf ökologischen Anbau umzustellen.
Das Innenministerium begründete das Verbot der Konferenz im Kreis Kuldiga damit, dass diese Region noch nicht touristisch freigegeben sei. Die Kreisverwaltung hatte dagegen mehrfach gefordert, die wald- und seenreiche Region für den Tourismus zu öffnen.
Geheime militärische Projekte gebe es hier nicht. Hintergrund des Konflikts zwischen der Region und der Zentrale in Riga ist die neue Politik Gorbatschows. In Riga sitzen Konservative, die der Perestroika alle erdenklichen Steine in den Weg legen. Ihrer industriefreundlichen Politik ist die internationale Konferenz ein Dorn im Auge. Umweltschützer beklagen das Waldsterben im Baltikum durch sauren Regen und die Verschmutzung der Ostsee durch fehlende Kläranlagen. Hintergrund sind aber auch die Unabhängigkeitsbestrebungen der baltischen Staaten von der Sowjetunion. Auf lokaler Ebene fiel dieser Anspruch auf fruchtbaren Boden. Estland, Lettland und Litauen waren unabhängige Staaten, bevor sie durch den Hitler-Stalin-Pakt von der Sowjetunion okkupiert wurden.
Offenbar steht die Bevölkerung hinter der Umweltbewegung. Denn die Konferenz wurde durch finanzielle Zuwendungen von Kolchosen und Lebensmittelspenden von Bauern und Fischern aus der Region ermöglicht. Am Ende dieser ersten von unten organisierten internationalen Konferenz in der Sowjetunion soll ein Netzwerk stehen, das alle Umweltinitiativen der Ostseeanrainerstaaten zusammenführt.
Wieland Giebel
Abschlussbericht an die taz, abgesetzt Sonntag, 24. Juni 1989 aus Riga, 15 Uhr
Ostseekonferenz endet mit Provokation gegenüber Moskau.
Polizeichef geht mit Delegierten baden. Ostsee-Netzwerk gegründet.
Ostseekonferenz endet mit Provokation gegen Moskau.
Polizeichef geht mit Delegierten baden. Ostsee-Netzwerk gegründet.
Was hat der Polizeichef da drunter? Hundert Augenpaare waren auf ihn gerichtet, als er seine Hose auszog. Clever. Die Badehose. Zum Abschluss der Ostseekonferenz in Edole bei Riga gingen die Konferenzteilnehmer gemeinsam mit der örtlichen Polizei baden – in einem märchenhaften Waldsee Lettlands. Zuvor fand die zunächst abgesagte ökologische Rundfahrt doch noch statt. Und zwar unter Polizeischutz und Blaulicht. Eine gewaltige Provokation gegenüber Moskau. Lettland ist Lettisch und wird nicht von Moskau kontrolliert. Das sollte hier demonstriert werden. Inzwischen sind die Widersprüche deutlicher geworden. Der „Club zur Verteidigung der Umwelt“ fordert nicht mehr nur das Selbstbestimmungsrecht des lettischen Volkes innerhalb der Sowjetunion, sondern die Unabhängigkeit der baltischen Staaten. Zur Eröffnung der Konferenz am vergangenen Montag war die lettische Fahne in der Kirche gesegnet, in einem Festzug zum Tagungsschloß gebracht und feierlich gehisst worden.
Die Konferenz war vom lettischen Ministerpräsidenten Vilnis-Edwins Bresis zumindest am Tagungsort verboten worden. Der „Verein zur Verteidigung der Umwelt“ VAK ist legal, aber wegen seiner radikalen Haltung in ökologischen und patriotischen Fragen nicht sehr beliebt. Die Regionalpolizei der Region Kuldiga war am Tagungsort zusammengezogen worden, weigerte sich aber einzugreifen, da keine kriminellen Handlungen vorlägen. Premierminister Bresis hätte nun eine Sondereinheit schicken müssen, wollte aber angesichts der internationalen Öffentlichkeit keine Eskalation. Im September wird der neue lettische Sowjet gewählt. Kuldiga ist kein militärisches Sperrgebiet, wird aber von Moskau für Touristen gesperrt. Die Letten akzeptieren diese Einschränkung nicht und nutzen die Konferenz, um Boden gut zu machen. Nicht alle deutschen Teilnehmer können den Affront gegen Moskau verkraften.
Lenin schloss mit Lettland einen Vertrag, der die Unabhängigkeit des Staates garantierte. „Es besteht die ernste Hoffnung, dass wir in absehbarer Zeit enge wirtschaftliche Beziehungen zu Lettland haben werden, das uns im Warenaustausch mit Westeuropa nützlich sein wird“, hieß es im Bericht des Rates der Volkskommissare vom Dezember 1920 (LW 31/486). Doch nach dem Hitler-Stalin-Pakt besetzte die Rote Armee das Land. Mehr als 60.000 Menschen starben innerhalb eines Jahres, jede Familie war betroffen. Erst jetzt werden die Massengräber geöffnet, die Erinnerung, der Hass bricht auf.
Die Konferenz zum Schutz der Ostsee, die von der Bremer „Aktionskonferenz Nordsee“ mitorganisiert wurde, verlief nicht stromlinienförmig wissenschaftlich. Im Vordergrund standen die menschlichen Beziehungen zur Umweltbewegung in Skandinavien, der DDR (Arche) und der Bundesrepublik. Die überwältigend herzlichen und um das Wohl der Gäste bemühten Gastgeber und Delegierten kamen gemeinsam in der Mittsommernacht, dem Sonnenwend- und Fruchtbarkeitsfest, zum Höhepunkt der Konferenz.
Die Grüne Bewegung Lettlands versucht, sich von den Bindungen der Exil-Letten zu lösen, die mit Leuten wie Hans Graf Huyn, dem ostpolitischen Sprecher der CSU, und Heinrich Lummer, der die Republikaner als möglichen Bündnispartner der CDU sieht, zusammenarbeiten. „Nach unseren grünen Kriterien gibt es keinen Unterschied in der Wachstumsideologie zwischen Ost und West“, heißt es in einem Arbeitspapier der Konferenz. Unterstützung erhalten die lettischen Umweltschützer von ihren westdeutschen Kollegen demnächst durch ein Wasser- und Ernährungslabor. Die nächste Ostseekonferenz wird in der Bundesrepublik stattfinden.
Nachtrag nach meinen Notizen: Am Wochenende traf sich in Riga/Lettland die ukrainische Befreiungsbewegung und stellte ein Programm gegen den „roten Terror“ in der Ukraine auf.
Aus einer Kloake kann selbst die Natur keinen gesunden Fisch zaubern
Missbildungen bei der Geburt, Waldsterben, vergiftetes Wasser im Baltikum.
Die radioaktive Belastung ist zehnmal höher als bei den Atombombentests.
„Wir wollen uns vor den anderen Ostseeanrainern nicht schämen müssen“, sagt der Bürgermeister von Jurmala, der Badestadt bei Riga, „innerhalb von fünf Jahren muss die Schadstoffbelastung halbiert werden. Aber wie? Das Problem ist die Zentralverwaltungswirtschaft. Das Geld, das wir verdienen, bleibt nicht hier. Nur der Dreck. Die Umweltverschmutzung ist unser Hauptproblem. Wenn wir die Umweltprobleme nicht in den Griff bekommen, können wir weder den Tourismus entwickeln, noch unsere Wirtschaft auf andere Weise in den Griff bekommen“.
Riga war die erste Station der ökologischen Rundreise, zu der der lettische „Club zur Verteidigung der Umwelt“ gemeinsam mit der „Aktionskonferenz Nordsee“ eingeladen hatte. Entgegen dem Verbot des lettischen Innenministeriums hatten Polizei und Kreisrat von Kuldiga die „Konferenz zum Schutz der Ostsee“ unter ihren Schutz gestellt. Ihr Motto: Alle Macht den Räten, und zwar den lettischen und nicht der Zentrale in Moskau oder der lettischen Hauptstadt Riga. Bislang hatte die Regionalverwaltung keine Möglichkeit, sich gegen die Industrialisierung zu wehren. Doch die Perestroika von oben und die Umweltbewegung von unten setzen die starren Ministerien unter Druck.
Wieland Giebel
Das Baltikum belastet die Ostsee
Die Region Riga gilt als größter Einzelverschmutzer der Ostsee. „Darf’s ein bisschen mehr sein“, scheint das Motto zu sein, denn es gibt jede Menge Verschmutzungen. Badestrände sind wegen ungeklärter Abwässer gesperrt, der Tourismus geht zurück. Kolibakterien als Folge von Fäkalieneinleitungen lassen sich leicht nachweisen. Wie hoch aber die chemische Belastung ist, bleibt offen.
Staatliche Daten werden nicht veröffentlicht. Deshalb wollen die westdeutschen Umweltschützerinnen ihren lettischen Kolleginnen ein Labor zur Verfügung stellen. Das Trinkwasser für Riga ist durch die Chemie- und Pharmaindustrie der Städte Incukalns und Olaine belastet. Der Fluss Lielupe, der den Giftmüll in die Ostsee transportiert, wird durch eine Papierfabrik in der Kleinstadt Sloka verseucht. In Riga überschreitet die Luftverschmutzung durch die Schwerindustrie die zulässigen Werte um das Zwanzigfache. Dreckschleuder Nummer eins ist wiederum die Industrie der Stadt Olaine. Aber auch die 500 Kilometer lange Straße entlang der Ostseeküste zwischen Leningrad und Riga macht den Eindruck eines Waldsterben-Lehrpfades: Lametta-Syndrom bei Kiefern und Fichten, sie lassen die Äste hängen, sie nadeln aus, das Längenwachstum ist verkürzt, sie haben zusammengeschrumpfte Krähennestkronen. All das sind deutliche Anzeichen für sauren Regen. Selbst die schnell wachsenden Birken in der Nähe von Fabriken sehen aus, als hätte man sie mit Phosphor übergossen. Neben dieser hausgemachten Wasser- und Luftverschmutzung befindet sich in der Stadt Baldone ein Lager für atomare und chemische Abfälle aus Ost und West.
Geburtsdefekte und Allergien
Die Hafenstadt Ventspils ist durch eine Chemiefabrik und Raffinerie des Amerikaners Armand Hammer, Occidental Petroleum, verseucht. Für die Erdbebenopfer in Armenien hat er eine Million Dollar zur Verfügung gestellt. Für Ventspils sollte er die nächste Million locker machen, fordert Arvantds Ulme, Chef des „Clubs zur Verteidigung der Umwelt“. Denn eine staatliche Kommission hat Grenzwertüberschreitungen bis zum Achtzigfachen der sowjetischen Normen festgestellt.
Bei der Öl- und Gasverladung entweichen jährlich 2.500 Tonnen verdampfte (gasförmige) Fraktionen in die Luft. Der Bau einer Öl- und Ammoniakpipeline sowie einer Stickstofffabrik ist geplant. Eine halbe Million Tonnen Kalisalze haben die Stadt bisher belastet: 600 Bäume sind abgestorben. Wie immer trifft es die Schwächsten am härtesten: Geburtsfehler haben sich in den letzten zehn Jahren verdreifacht, Schwangerschaftskomplikationen verzehnfacht, hinzu kommen Hautallergien und Asthma bronchiale bei Kindern.
Hinzu kommen militärische Gefahren für die Küstenbewohner: In der Ostsee wurden in den letzten Jahren Phosphorbomben gesprengt. Doch die festen Bestandteile werden an die Küste gespült, sehen aus wie Bernstein und führen zu schlimmen Verätzungen. Ostseefischer klagen: „Seit Ende der 70er Jahre nehmen bei uns die Fischkrankheiten zu, vor allem sehen wir mehr Geschwüre und Flossenfäule. Der Verbraucher kann die Krankheiten aber nur bei frischem Fisch erkennen. Der größte Teil wird verarbeitet.“ Die Ostseefischer fürchten um ihre Existenz.
Eine der wenig beachteten Ursachen für Fischkrankheiten ist die Radioaktivität. In der Ostsee schwimmt heute kein Fisch mehr, der nicht radioaktiv belastet ist. Seefisch galt immer als sauberes Lebensmittel, auch als die Umweltverschmutzung an Land zum Problem wurde. Aber aus einer Kloake kann auch die Natur keinen sauberen Fisch zaubern. Für Schwangere, Stillende und Kleinkinder ist (Ost-)Seefisch wegen der chemischen und radioaktiven Belastung heute nicht mehr unbedenklich. Während der Umweltausschuss des Europäischen Parlaments für die genannten Gruppen einen Orientierungswert von maximal 5 Becquerel Cäsium pro Kilo Lebensmittel empfiehlt, ist Seefisch nach dem Monatsbericht des Bundesgesundheitsamtes vom Oktober 1988 tatsächlich mit durchschnittlich 9 Bq/kg Cäsium belastet.
Die östliche Ostsee ist durch die oberirdischen Atombombenversuche radioaktiv vorbelastet. Aus diesen Jahren liegen genaue Zahlen vor, die einen Vergleich mit der Belastung durch Tschernobyl ermöglichen. Von 1961 bis 1963, auf dem Höhepunkt der Atombombentests, verdreifachte sich der Strontium-90-Gehalt in der Ostsee von 15 Bq/m3 auf 44 Bq/m3. Strontium gilt als hundertmal gefährlicher als Cäsium. Der Gehalt an Cäsium-137 stieg im gleichen Zeitraum um das Fünffache von 15 Bq/m3 auf 78 Bq/m3.
Nach Einstellung der oberirdischen Bombenversuche im Jahr 1963 sank die Radioaktivität bis 1977 wieder auf jeweils 26 Bq/m3 für beide Radionuklide. Die Belastung des Kabeljaus lag damals bei durchschnittlich 4 Bq/kg Cäsium.
Das Deutsche Hydrografische Institut schreibt zu seinen Untersuchungen nach Tschernobyl: „Da die Ostsee fast ein Binnengewässer ist, muss damit gerechnet werden, dass die Radioaktivität, die hier eingetragen wird, über lange Zeiträume im Meer verbleibt. Nach Messungen der Bundesforschungsanstalt für Fischerei liegen die Aktivitäten in der Nordsee zwischen einem und zehn Bq Cäsium pro Kilogramm Fisch. In der nördlichen Ostsee ist nach dem Reaktorunfall von Tschernobyl mit etwas höheren Aktivitäten zu rechnen, die auch über 100 Bq/kg liegen können“.
Das wären enorm hohe Werte, die nach den vorliegenden aktuellen Messungen (noch) nicht erreicht werden. Der Cäsiumgehalt von Dorsch, Hering, Makrele, Steinbutt, Scholle und Flunder in der Ostsee beträgt bis zu 10 Bq/kg Cäsium. Aber: Fische stehen am Ende der Nahrungskette im Meer, sie ernähren sich von Plankton, in dem sich Radioaktivität anreichert. Es kann also durchaus noch zu höheren Belastungen der Fische kommen.
Die höchste Aktivität in der Ostsee wurde im Bereich der Aalandsee zwischen Schweden und dem Baltikum gemessen. Dies entspricht dem hohen Fallout in Mittelschweden, wo die Belastung durch kontaminierte Rentiere bekannt ist. Auf den Inseln Gotland und Öland lag der Cäsiumgehalt bei 890 mBq/l und im Bottensee zwischen 500 und 700 mBq/l. Erstaunlicherweise finden sich in den aktuell veröffentlichten Wassermessungen keine Vergleichswerte zu den Zahlen vor Tschernobyl. Warum, wird klar, wenn man nachrechnet: 700 mBq/l sind 700 Bq/m3, das ist zehnmal mehr als die maximale Belastung von 78 Bq/m3 vor Tschernobyl zur Zeit der oberirdischen Atombombentests. 30 Jahre dauert es, bis Cäsium zur Hälfte abgebaut ist. 30 Jahre ist auch der Zeitraum, in dem das Wasser der Ostsee einmal umgewälzt wird.
Sauber ist die Ostsee damit aber noch nicht. Denn die Anreicherungen im Boden und in Kleinstlebewesen werden durch den Wasseraustausch nicht rückgängig gemacht. Der ganze Dreck bleibt also noch Jahrzehnte in der Ostsee.
Wieland Giebel