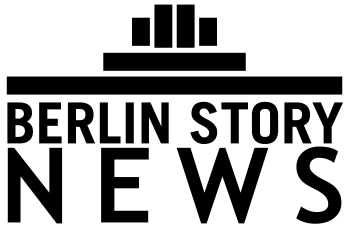Mit dem Rettungswagen nach Syrien
„Wir bleiben solange, wie wir die Sicherheit unseres Teams sicherstellen können“, sagt mir der Mitarbeiter von Cadus, während er auf die Meldungen auf dem Bildschirm starrt. Das Büro ist ein Dauer-Provisorium, eine zweite Etage ist mit Gerüstbauteilen realisiert. Durch das rote Licht bei Nacht erinnert es mich an die Einsatzbeleuchtung auf einem Kriegsschiff. Aber mit Krieg will hier niemand etwas zu tun haben – im Gegenteil. „Aber du kannst ja nicht weggehen, wenn das Leben anderer von dir abhängt. Wat mutt das mutt“, ergänzt eine Kollegin.
Der Berliner Verein hat sich 2014 gegründet. Er besteht aus vielen bunten Menschen, die oft einen medizinischen Hintergrund haben und die ohne Ansehen der Person anderen helfen. Um diese Aufgabe zu erfüllen, muss man meist in den Krieg gehen. Über den Krieg in Syrien berichtet die ARD gerne aus Kairo. Das ist nicht einmal der gleiche Kontinent. Die Retter von Cadus melden sich im Büro und geben einen kurzen Bericht des Tages ab: Aus Al Hol, Raqqa, Hesekeh. Alles Orte, die man aus den Nachrichten kennt. Alles Gegenden, die für schlimmste Menschenrechtsverletzungen stehen. Alles Orte, in denen kein normales Leben mehr möglich ist. Cadus managed Krankenhäuser, bringt Ärztinnen und Ärzte und weiteres medizinisches Personal in die Gegend und versorgt diese mit allem, was sie zum Arbeiten brauchen.

„Gestern wurden die Rettungswagen unserer Partner angegriffen.“ – Ein Kriegsverbrechen. Ich denke mir nur „Ah, mal wieder“. Ich weiß nicht, wie viele Kriegsverbrechen ich in meinen acht Jahren in Kurdistan-Irak gesehen habe. Die Genfer Konvention wird im Krieg etwa so sehr beachtet wie Verkehrsregeln in Deutschland. Es ist schlimm, dass man so abstumpft. Aber anders geht es nicht.
Kurdistan ist nicht gleich Kurdistan
Ich versuche in diesem Wirrwarr aus Informationen zu verstehen, was Cadus wie und für wen tun. Ich kenne mich in Kurdistan-Irak gut aus. Das mag aus der europäischen Sicht das gleiche sein wie „Rojava“, also das kurdische Gebiet in Syrien. Es sind aber zwei Welten. Die Peschmerga, also die Armee der Autonomen Region Kurdistan im Irak, wird vom Westen unterstützt und ist Teil der irakischen Streitkräfte. Sie wurden von der türkischen Armee ausgebildet und mit Waffen ausgestattet. In Syrien kämpft auf der kurdischen Seite die YPG, eine Armee mit losem Kontakt zur PKK. Stark vereinfacht könnte man sagen: In Kurdistan-Irak sind die westlich orientierten Kapitalisten, in Rojava (Syrien) die Sozialisten, die ihr eigenes Ding durchziehen wollen. Aber die Lage in Syrien ist viel komplizierter, als man hier in einem Satz erklären könnte. Nach Kurdistan-Irak kann ich einfach mit dem Flugzeug, fünfzehn mal pro Woche und erhalte ein Stempel-Visum bei der Einreise. Wollen die Cadus-Leute nach Rojava, so beginnt ihr Weg erst dort so richtig, wo er für mich sonst endet.
Der Weg zum Krieg
Vom internationalen Flughafen in Erbil aus müssen sie mit dem Auto mehrere Stunden Richtung Westen fahren, bis sie die kurdisch-kurdische (oder irakisch-syrische) Grenze erreichen. Dort beginnt das Gebiet einer anderen Administration mit anderen Regeln. Von den Leuten, die dort hin gehen, hat kaum jemand ein syrisches Visum. Assad möchte nicht, dass den Opfern des Krieges geholfen wird. Die Kurden sind ihm ein Dorn im Auge. Am liebsten wäre es ihm wohl gewesen, wenn sich IS und Kurden gegenseitig abgeschlachtet hätten. Dann hätte er seine Leute in dem Gebiet ansiedeln können. Die kurdischen Kräfte lassen die Helfer gerne passieren – dennoch gibt es hier eine Bürokratie, die einen auf dem Weg aufhält. Danach beginnt ein düsteres und vom Krieg gezeichnetes Gebiet. Und dennoch versuchen die Menschen, die dort wohnen, gute Laune zu behalten. Sie feiern Feste, sie bauen neue Häuser und sie setzen Kinder in die Welt. Sie geben sich einfach nicht damit ab, dass man sie ausrotten will.
Von Sozialisten und Imperialisten
Die einzigen Verbündeten, die die syrisch-kurdische YPG in den vergangenen Jahren hatte, sind wenige westliche Kräfte unter der Führung der USA. Auch britische, französische, israelische und kanadische Spezialeinheiten sind in Syrien aktiv, aber nur in kleiner Mannstärke. Dieses Bündnis stand von Anfang an auf wackeligen Beinen. Selbstverwaltete Sozialisten, die dem Imperialismus und Kapitalismus abschwören, arbeiten mit dem Klassenfeind zusammen – Krieg macht erfinderisch. Und wenn man mit dem Rücken zur Wand steht, was soll man machen? Sich einfach ermorden lassen? Das Bündnis hielt länger und funktionierte besser, als ich gedacht hätte. Über Jahre klappte die Zusammenarbeit gut. Regelmäßig sah ich die Transporthubschrauber und die LKW-Konvois von Kurdistan-Irak aus starten. In Erbil und südlich von Mossul in der Q-West Airbase haben die Amerikaner ihr Lager aufgeschlagen.
Rettungskräfte im Krieg

Und mitten in dieser Gemengelage, zwischen Gruppen die kaum noch jemand zuordnen kann, in Bündnissen, die jeden Tag anders sein können, sitzt Cadus. Der Leuchtturm im Orkan. Hier geht man hin, wenn man sich noch bewegen kann und wenn man Rettung braucht. Das Leid, was man hier tagtäglich erlebt, ist nicht auszuhalten: Ein kleines Mädchen, dem von einer Mörsergranate ein Bein abgerissen wurde. Ein alter Mann, der blutet und blutet – aber es ist unklar, woher das Blut kommt. Eine Familie, die weinend und vor Verzweiflung schreiend um ihren toten Sohn sitzt. Völlig normaler Alltag hier für alle Beteiligten. Zurück in Berlin sehe ich ein neues Foto aus Syrien. Es zeigt den Kühlschrank mit den letzten Blutkonserven. Danach wird einfach gestorben – außer irgendwer kann irgendwo neue auftreiben. Auch das ist Alltag. Ich habe oft ähnliche Sachen gesehen und frage mich jedes Mal, warum sich andere Menschen so ein Ehrenamt antun. Egal, wie oft man es gesehen hat, es wird nicht besser. Man lernt später zu weinen, später zu kotzen und in dem Moment ein Pokerface zu bewahren. Man lernt einfache Sätze auswendig, mit denen man den Hinterbliebenen erklären kann, dass gerade ein geliebter Mensch gestorben ist. Aber am Ende kann man sich nie ganz dran gewöhnen.
Wechselnde Allianzen
Hat man das rote Kreuz auf der Kleidung, dem Krankenhaus oder dem Fahrzeug, so sollte einen das schützen. „Eher eine Zielscheibe, schön mittig markiert“, sagte mir mal ein belgischer Notarzt an der Front. Man muss einfach mit den Leuten klar kommen, die das Gebiet um einen herum unter der Kontrolle haben. Im Falle der Cadus Locations sieht das so aus: Im Norden die türkische Armee, im Westen Assads Armee, im Süden schiitische Milizen und ein bisschen IS dazu über einem die russische Luftwaffe. Etwa, wie ein Hase im Fuchsbau. Dieses Wissen, jederzeit durch eine Bombe getötet zu werden, nagt ebenfalls an den Nerven. In der vergangene Woche überschlugen sich die Ereignisse. Die amerikanische Administration hatte schon länger ein Problem mit der YPG. Die YPG bleib einfach bei ihren bekannten Positionen zu allem, die Amerikaner wollten aber im Kern, dass sich das System ändert. Man wollte anderen politischen Gruppen die Möglichkeit geben, sich an der Macht in dieser Gegend zu beteiligen. Gruppen, mit denen die Amerikaner leichter Deals machen können. Bereits im März waren einige Fahrzeuge der Amerikaner abgezogen worden. Ich traf eine Einheit von US-Armee einfach an einer Tankstelle nahe dem Lake Mossul. Dort erzählten sie mir das alles. Dass die türkische Armee für eine Invasion in den Startlöchern steht, war bekannt. US-Botschafter Grenell sprach oft mit Vertretern der Bundesregierung. Diese wollten keinen Druck auf Erdogan ausüben, obwohl sie gute Möglichkeiten hätten.
Die türkische Armee rückte vergangene Woche also ein und hinterließ nicht viel mehr als verbrannte Erde. In zwei Tagen flohen 200.000 Einwohner aus der Gegend. Nur wo sollten sie hin? Umgeben von Feinden bleibt nur Kurdistan-Irak. Die Region Kurdistan-Irak hat fünf Millionen Einwohner. Dazu kommen derzeit eine Million syrische Flüchtlinge, sowie eine Million Binnenflüchtlinge aus dem Irak.

Die Amerikaner waren noch in Rojava (Syrien), zogen sich aber zurück. Die französischen und britischen Special Forces wohnten bei den Amerikanern. Bei einem Angriff der türkischen Armee wurden zwei französische Soldaten verletzt. Sowohl die Türkei als auch die USA gaben Pressemitteilungen raus, die inhaltlich nicht falsch waren, aber doch Lücken ließen. Die Türkei sagte, sie hätten nicht auf die US-Basis gezielt. Die Amerikaner sagten, es seien keine Amerikaner verletzt worden. Doch das war nur ein kleiner Nebenschauplatz.
Nachdem eine russische IL-76 Transportmaschine in Quamishli gelandet war, fragten sich alle Beobachter: „Warum?“ Bringt sie etwas? Holt sie jemanden ab? Es sollte zwei lange Tage dauern, bis die Frage geklärt war: Die russische Armee verhing eine Flugverbotszone über Rojava, also den kurdischen Teil Syriens. Assads Armee rückte mit Hilfe russischer „Berater“ vor. Und in wenigen Tagen brachen alle bekannten Koalitionen zusammen. Die Kurden machten einen Deal mit dem Feind Assad. „Wir hatten die Wahl, abgeschlachtet zu werden oder einen Deal mit dem Feind einzugehen.“
Wenn man gehen muss
Damit waren alle internationalen Journalisten und alle westlichen Hilfsorganisationen de facto zum Abschuss freigegeben. In der Vergangenheit gab es genug solcher Fälle. In der Nacht erreichten mich die Nachrichten etlicher Organisationen „Wir gehen“, „Abzug“, „Sehen uns in Erbil“. Viele hatten Angst, dass der lange Treck auf der gut bekannten Route zum Angriffsziel werden könnten. Aus Rache nochmal eine Drohne drüber fliegen lassen oder so. Man kann die Fahrzeuge zwar problemlos mit GPS-Trackern ausstatten und vom Krisenstab aus beobachten, aber diese Tracker können relativ einfach von dritten geortet werden. Daher macht man einfach alle Geräte aus, fährt los und meldet sich, wenn man über die Grenze ist. Im Prinzip sagt man seinen Freunden vor Ort „Ich habe den richtigen Pass und darf raus – sieh mal zu, dass du nicht stirbst! Vielleicht bis nächstes Mal“. So würde das sicher niemand ausdrücken, aber das geht allen durch den Kopf. Verzweiflung und Wut über die Ohnmacht macht sich breit. Ich habe in der Nacht kaum geschlafen, dauernd die Meldungen auf dem Handy verfolgt. „85km“, „40km“, „20km“, „Erstes Fahrzeug rüber“. Die Textnachrichten kamen nach und nach. Am Montag Morgen um 8:34 dann von einem Freund an der kurdisch-kurdischen Grenze die Nachricht „Alle drüben. Alle sicher“. Also alle, die ich kenne und keine weiteren Fahrzeuge der Hilfsorganisationen in Sicht. Aber ein nicht enden wollender Stau von Flüchtlingen mit dem „falschen“ Pass.
In Erbil angekommen nahmen die Leute von Cadus dieses Video auf.
Und was nun?
Und nun? Sind alle Leute, die für Schutz und Nachschub sorgen konnten, weg. Die Augen der Welt sind verschlossen. Was am Ende egal ist, weil die meisten eh nicht hin sehen wollen. Die Uhren sind zurückgedreht auf 2011. Assad hat, dank des großen Bruders Russland, die Macht. An allen anderen wird er nun Rache üben. Wie Abba es sagten: „The history book on the shelf, is always repeating itself“.
Nicht alle Helden tragen Capes. Viele tragen einfach das Cadus-Logo. Und sie brauchen eure Hilfe. Moralisch, durch Zuspruch. In Reichweite, durch Teilen ihrer Arbeit und natürlich durch euer Geld.