Der ukrainische Weihnachtsmann an der Front
24. Dezember 2023, kurz nach zwölf Uhr mittags: Santa Claus erreicht, Schnee und Luftalarm zum Trotz, die ostukrainische Millionenstadt Kharkiv. In seinen roten Mantel gehüllt parkt er den Schlitten vor einem schmucklosen Verwaltungsgebäude am Stadtrand, schultert den schweren Sack voller Geschenke und fährt sich mit der Hand durch den dichten Bart. Die Bescherung kann losgehen.

In dem grauen Betonklotz stehen unterdessen etwa 150 Kinder und warten nervös auf die Ankunft des Weihnachtsmanns. Sie alle kommen aus Kupjansk, eine Stadt etwa 150 Kilometer weiter östlich, und wurden in den vergangenen Monaten vor dem russischen Artilleriebeschuss in Sicherheit gebracht. Noch immer ist die Stadt nur teilweise unter ukrainischer Kontrolle, in den vergangenen Tagen nahmen die Vorstöße der russischen Armee wieder zu. Doch zumindest heute, zur Heiligen Nacht, soll der Krieg wenigstens kurz vergessen werden können.

„Hohoho!“, ruft Santa mit tiefer Stimme und schiebt seine gewaltige Erscheinung durch die aufgeregte Menge. „Wer möchte denn hier Geschenke haben?“, fragt er auf Ukrainisch. Die Kinder huschen über den gebohnerten Linoleumfußboden und winken dem Weihnachtsmann zu. Erst der Anblick des geschmückten Baumes, dann die vielen aufgereihten Geschenke darunter – und nun wird ihnen Santa Claus auch noch persönlich ein Paket überreichen.

Während sich die Menge um den Weihnachtsmann schart, hocken Richard und Liz vor mehreren Kisten und sortieren die verpackten Geschenke. „Ich hab hier noch ‚Junge, Alter 3-6‘“, sagt Richard und wirft Liz ein Geschenk rüber.
Richard kommt eigentlich aus Berlin, hat früher als Anwalt gearbeitet. Liz ist in Moskau geboren, hat Wirtschaft studiert und es bedurfte vieler Zufälle und noch mehr Willenskraft, dass sie nun hier auf dem Fußboden hocken dem Weihnachtsmann assistieren.

Nur wenige Tage nach dem Angriff Russlands am 24. Februar 2022 hatten sich beide mit einigen Gleichgesinnten in einer Initiative zusammengeschlossen und halfen den ankommenden Geflüchteten mit Unterkunft, Verpflegung und Geld aus.
„Liz hatte damals diese WhatsApp-Gruppe erstellt“, erklärt Richard. „Der erste Mensch, dem wir damals geholfen haben, war eine junge Ukrainerin, die Liz in Berlin auf einer Parkbank gefunden hatte: ‚Alex, 21, sucht dringend eine Unterkunft‘, hat sie damals geschrieben. Als wir uns dann später als Hilfsorganisation in Litauen haben registrieren lassen, haben wir den Namen Alex21 einfach behalten.“ Für ihre Hilfsarbeit geben sie vieles auf – unter anderem auch ein Weihnachtsfest mit der eigenen Familie in der Heimat.
Der wievielte Einsatz das inzwischen ist, können beide gar nicht mehr genau sagen. Liz und Richards Fahrten in die Ukraine sind zur Routine geworden. Sie transportieren Hilfsgüter in die befreiten Gebiete oder statten, wie am heutigen Tag, Santa mit Weihnachtsgeschenken aus – alles auf freiwilliger Basis. „Ich hab meine Wohnung in Berlin untervermietet“, erzählt Richard. „Wenn ich überhaupt mal in Berlin bin, penne ich abwechselnd bei meiner Mutter oder bei meiner Tochter auf der Couch.“ Vielleicht auch deshalb fühlt er sich inzwischen eher im westukrainischen Lviv beheimatet.
„Ich komme aus einer preußischen Offiziersfamilie. Währe ich noch in den 20ern geboren: Ich hätte mit Sicherheit mitgemacht damals.“ Ist seine Hilfsarbeit in der Ukraine also eine Art Wiedergutmachung der historischen Schuld? „Vielleicht ja.“ Richard entschuldigt sich und zieht ebenfalls ein rotes Weihnachtsmannkostüm über. Die Bescherung beginnt und die Kinderaugen leuchten noch heller als ohnehin schon.
Dass der Weihnachtsmann am 24. Dezember nun auch in Kharkiv einen Stopp einlegt, ist für die Ukraine eine vergleichsweise neue Situation. Das orthodox-geprägte Land feierte vor der russischen Invasion gewöhnlich erst am 7. Januar das Weihnachtsfest – ein weiterer emanzipatorischer Schritt, sich von der sowjetischen Vergangenheit zu lösen. Die Kirche hat sich bereits von der russisch-orthodoxen abgespalten. Landesweit werden Plätze und Straßen umbenannt, Hammer und Sichel aus den Stadtwappen entfernt, und den Triumphbogen der sowjetischen Völkerfreundschaft in Kyiv ziert seit einiger Zeit ein unübersehbarer, aufgemalter Riss.

Als wollte Wladimir Putin noch einmal verdeutlichen, was er von diesem vorgezogenen Weihnachtsfest hält, heulen die Sirenen am heutigen Tag insgesamt fünfmal. Einschläge gibt es, zumindest über Weihnachten, keine.
Einen Tag später haben Liz und Richard in der Kleinstadt Barvinkove, etwas mehr als zwei Autostunden von Kharkiv entfernt, ihren nächsten Einsatz. Frisch gefallener Schnee knirscht unter den Schuhsohlen, während sie die neu eingebauten Fenster des Kindergartens begutachten. Die Frontlinie ist nun noch wenig wenige Dutzend Kilometer entfernt. Hin und wieder kann man das Fauchen ukrainischer Jets in der Luft hören. Die russische Artillerie, sagt man, sei aber außer Reichweite.
Vor einigen Wochen wurde hier im Ort auf Initiative der Gruppe eine Wasserfilteranlage installiert, die das schmutzige Leitungswasser trinkbar macht. Inna, die Leiterin des Hauses, reicht Richard eine Plastikflasche mit Wasser im Originalzustand.

Richard nimmt vorsichtig einen Schluck, dann spuckt er das Leitungswasser in hohem Bogen und mit angewidertem Gesicht aus. „Ist das eklig!“, ruft er und spült hastig ein paar Schlucke mit dem frisch gefilterten Wasser hinterher.
Noch vor einem Jahr war Barvinkove wochenlang von der Außenwelt abgeschnitten. Russische Soldaten hatten die Stadt umstellt, die meisten der Anwohner waren geflohen, die Wasser- und Stromleitungen wurden von den Besatzern gekappt, die umliegenden Felder vermint.
Im April vergangenen Jahres, nur wenige Wochen nach Beginn der russischen Offensive wurde der Vormarsch im benachbarten Isjum erstmalig gestoppt. Russland geriet in die Defensive, die Invasoren wurden bis an die Grenze zum benachbarten Oblast Donezk getrieben. Die Frontlinien verschieben sich seitdem kaum noch, während das Leben Stück für Stück in die Städte ringsum zurückkehrt. Die Kriegsschäden sind überall sichtbar: zerstöre Wohnhäuser, Granatenkrater im Asphalt oder ausgebrannte Panzer, die rostend im Straßengraben liegen.

Die Instandsetzungsarbeiten am Kindergarten wurden erst kürzlich abgeschlossen. Weiterhin sei dies der einzige Ort in der Stadt mit stabiler Elektrizität, erzählt Leiterin Inna. „Im Januar wollen wir wieder regulär öffnen. Schon jetzt kommen aber viele Kinder tagsüber hierhin: Hier ist es immerhin den ganzen Tag warm.“ Auch wegen der Filteranlage bilden sich nun regelmäßig lange Schlangen vor dem Gebäude. Der Andrang wurde so groß, dass eines Tages die Vize-Bürgermeisterin vorschlug, für das gefilterte Trinkwasser Geld zu verlangen.
Richard zieht hörbar Luft ein. „So eine Scheiße“, murmelt er. Dass habe er schon häufig erlebt, dass Einzelne versuchen, aus der Not der Menschen auch noch Geld zu schlagen. Weiterhin ist die Ukraine ein hochkorruptes Land. „Deshalb ist für uns eine der wichtigsten Regeln: Wir helfen Individuen, keinen Institutionen. Soweit wir die Leute ein wenig kennen, kann ich besser einschätzen, ob die uns bescheißen wollen.“
Nur wenige Stunden später sitzen Richard und Liz auf winzigen Stühlen und lauschen andächtig einer Schulaufführung. Ukrainische Mädchen in traditionellen Gewändern tanzen und singen ein Volkslied, umringt von noch kleineren Kindern, die mit weit geöffneten Augen den Geschenkeberg begutachten, der sich vor ihnen aufgetan hat.
Richard greift in seine Westentasche und holt eine Packung Seifenblasen heraus. „Die sind der absolute Renner“, sagt er. „Wir verteilen die auch an Soldaten. Einmal hat man uns erzählt, dass ein ganzes Bataillon tagelang eingekesselt war. Die Jungs wussten nicht, ob sie die nächste Nacht überleben werden. Dann hat einer unsere Seifenblasen rausgeholt und alle haben sich krumm und schief gelacht.“
Er pustet eine Salve in die tosende Kindermenge, hält kurz inne und wischt sich die Tränen aus dem Gesicht. Vielleicht ist es Rührung über das Geleistete – vielleicht auch das schlechte Gewissen, nicht mit den eigenen Kindern zuhause zu feiern. „Meine älteste Tochter ist jetzt 26, die kann das nachvollziehen, warum ich hier bin. Mein 15-jähriger Sohn nicht so. Vielleicht wird es es, wenn er älter ist.“
Kurz darauf ist die Bescherung vorbei, die Kinder gehen glücklich und beschenkt nach Hause. Der Bürgermeister der Stadt, ein knorriger Mann mit starren Gesichtszügen, steht unbeholfen in der Aula herum und kämpft mit den Tränen. „Ich hab die Kinder seit zwei Jahren so nicht mehr gesehen“, sagt er.
Zwei Teenager wollen Liz zum Abschied umarmen und beginnen zu weinen. Liz ringt kurz um ihre Fassung, entscheidet sich schließlich aber gegen einen Gefühlsausbruch. „Sonst verwischt das ganze Make-Up.“

Vor dem Schulgebäude hat unterdessen Richard eine gewaltige Schneeballschlacht inszeniert. Wurfgeschosse schlagen links und rechts neben ihm ein, die Kinder stürzen sich todesmutig auf den albernen Erwachsenen. Ein schlecht gelaunter Hausmeister bittet darum, nicht gegen die Fenster zu werfen. „Sorry, don’t understand“, sagt Richard und feuert die nächste Schneerakete ab.
Es ist Abend geworden. Das Schneetreiben hat nachgelassen, Tauwasser sammelt sich in großen Pfützen, während sich die Autokolonne ihren Weg über die zerstörten Landstraßen bahnt. Liz ist immer noch sauer wegen der Vize-Bürgermeisterin, die versucht hatte, Profit aus ihrer Wasserfilteranlage zu schlagen. „Jetzt wo wir den Bürgermeister kennengelernt haben“, sagt sie, „können wir doch auf dem Rückweg mal kurz in seinem Büro vorbeischauen, oder?“
Kurz darauf sitzen die zwei Aktivisten mitsamt Reporter und Fotograf im Büro von Oleksander Balo. Auf seinem Schreibtisch steht ein Bild seines Enkels, den er vor zwei Jahren mit dem Rest seiner Familie nach Leipzig hat evakuieren lassen. „Ein Bild vom Präsidenten werden sie bei mir nicht finden“, sagt er. Sowohl seinen Enkel als auch seine Kinder habe er seit zwei Jahren nicht mehr gesehen.
Liz bittet ihm um ein Videostatement. Er solle klarstellen, dass die Filteranlage für jeden im Ort da ist, ohne zusätzliche Kosten. Oleksander Balo schaut ein wenig betreten zu Boden. Dann dankt er erneut für die Unterstützung. „Ihr seid die ersten, die tatsächlich wiedergekommen sind.“ Das Wasser in Barvinkove, sagt er, bleibe für jeden zugänglich.
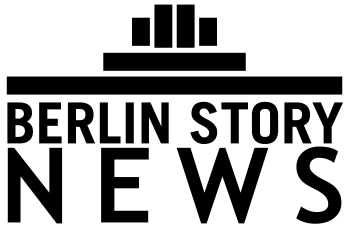
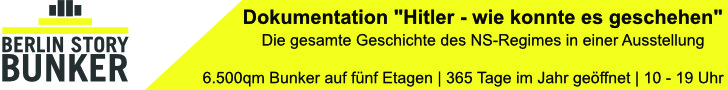
Ein Kommentar